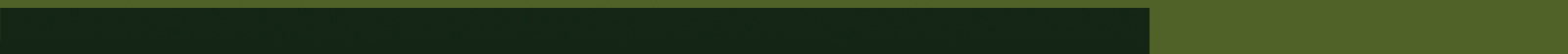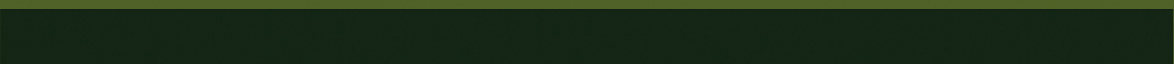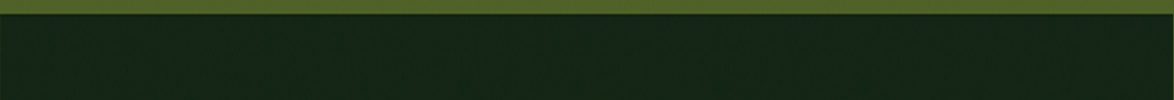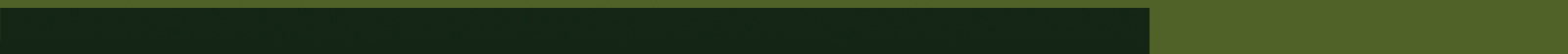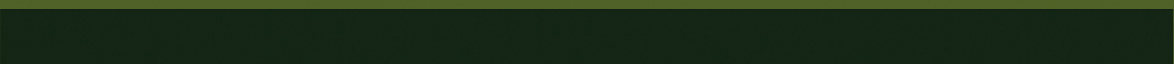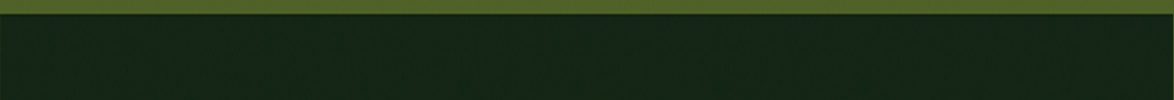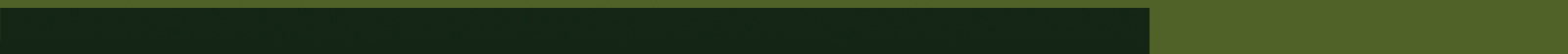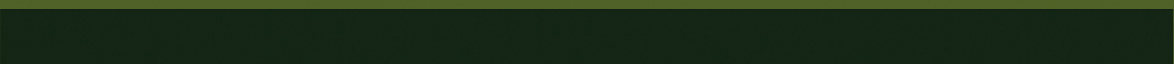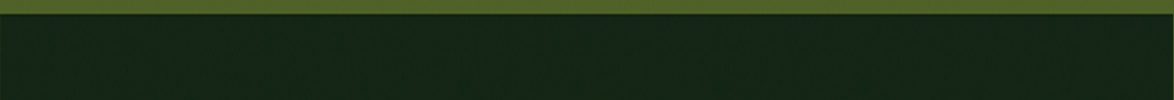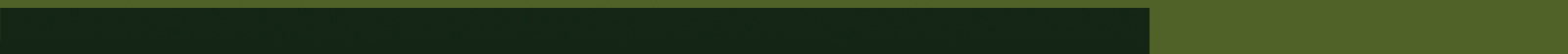
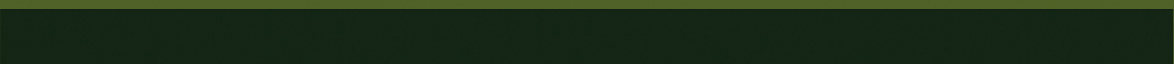
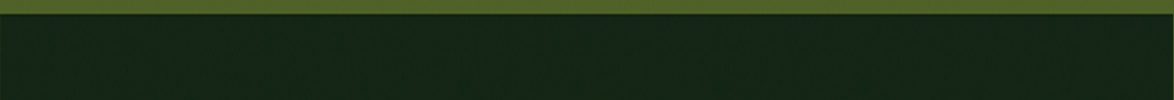
MICHELANGELO. LEONARDO. RAFFAEL. REMBRANDT.
Renaissance heißt Wiedergeburt. Gemeint war mit diesem Wort die Wiedergeburt der Antike. Doch sollte das keineswegs so etwas wie die Wiederbelebung eines Leichnams bedeuten, dazu war diese Zeit einer erneuten Hinwendung zur diesseitigen Wirklichkeit viel zu vital und selbstbewusst. Man führte kaum mehr als einen ständigen Dialog mit der Antike, deren überlieferte Schriften nach dem Fall Konstantinopels im Jahre 1453 durch eine Flut von gelehrten griechischen Flüchtlingen in den Westen gerettet und eifrig übersetzt worden sind, zumal Platon, und deren archäologische Spuren allerwärts in Italien, besonders natürlich in Rom, zufällig, aber nachgerade auch bei systematisch durchgeführten Ausgrabungen, entdeckt wurden. In Florenz sammelten die Medici begierig Altertümer, und in Rom begann ein Sammler-Wettlauf der Renaissance-Päpste zu Begründung und Bereicherung der vatikanischen Antiken-Sammlungen, die noch heute dort bewundert werden können. Der spektakulärste Fund war derjenige der „Laokoon-Gruppe“ im Jahre 1506, die nachhaltigen Eindruck auf Michelangelo gemacht hat. Das alles zusammen half, der neuen Lust am Leben, die dem antiken Lebensgefühl als verwandt empfunden wurde, auch einen vergleichbaren Ausdruck zu verschaffen. Daher kann das neue Bild des Menschen, des Menschen der Renaissance, ihr Ideal des Menschen, die Rühmung seiner Schönheit, Größe und Würde, ohne dieses Vorbild der Antike wohl kaum verstanden werden, so weitgehend man sich de facto dann davon zu unterscheiden wusste.
Der abermalige Stolz auf Größe und Ruhm des menschlichen Geistes und eine verwandte Bewunderung für die natürliche Schönheit des menschlichen Leibes ließen die christliche Jenseitsflucht und fromme Demut des Mittelalters als selbstverständlich höchste Werte einigermaßen verblassen. An die Stelle des weltentfremdeten Heiligen und seiner Jenseits-Ängste und -Hoffnungen trat ein Mensch, dem sich frisch die Augen für die Schönheiten dieser Erde geöffnet hatten und der sich als ihr Herr und Meister zu fühlen begann. Die Renaissance-Kunst hat solch diesseitigem Ideal von Welt und Mensch ruhmvolle Gestalt verliehen, und man fühlte sich dabei eher als gleichrangiger Rivale der antiken Meister denn als ihr bloßer Nachahmer. Das Höchste, was Vasari zur Preisung seines Idols Michelangelo zu sagen wusste, war, dass er „seinen Werken so viel Schönheit, Anmut und Lebendigkeit ... verlieh, dass er, wie ich ohne Kränkung irgendeines anderen sagen darf, die Alten übertroffen hat“ (Künstler der Renaissance, S. 367). Im Zusammenhang mit der Aufstellung des „David“ im Jahre 1504 insistierte er darauf, das Werk habe „alle modernen und antiken Statuen um ihren Ruhm“ gebracht (S. 329, und der Schönheit seines Moses komme keine antike Statue gleich (vgl. S. 334).
Selbstredend muss dies zeitgenössische Urteil teilweise revidiert werden, die Meisterwerke der klassischen griechischen Kunst harrten damals erst ihrer Entdeckung. Doch einen Mangel an Selbstbewusstsein wird man der geistigen Elite der Renaissance wahrlich nicht vorwerfen können, die Wertung Vasaris dürfte von der Eigenschätzung der großen Meister wohl kaum allzu sehr abgewichen sein, eines Michelangelo, Leonardo, Raffael. Zu Recht könnte nämlich ein Zugewinn der Renaissance-Kunst gegenüber der Antike reklamiert werden, der ihr eine gewisse Überlegenheit zuzubilligen ließe: die neuartige Meisterung in Darstellung von Innerlichkeit, Seele, Individualität. Und das muss den Künstlern als ureigenste Absicht und bewundernswert gelungene Leistung voll bewusst gewesen sein, die Meisterwerke der Skulptur und zumal der großen Renaissance-Malerei legen davon eindeutig Zeugnis ab. Aus den leeren Augen einer antiken Statue blickte kein Lebensschicksal; das Individuelle darzustellen, lag nicht in der Absicht klassischer antiker Kunst; aber durch jedes Renaissance-Antlitz lässt sich hindurchschauen in eine seelenvolle, einzigartige, unergründliche Innerlichkeit.
Demnach wurde eine innere Verwandtschaft mit der antiken Leben und Diesseits bejahenden Weltanschauung tief empfunden, man ließ sich von den gefundenen Werken anregen, lernte unermüdlich von ihnen und fühlte sich begeistert und ermutigt zu diesem Aufbruch ohnegleichen, der sich aus der mittelalterlichen, goldenen Jenseitsfiktion zur bunten Realität des Diesseits zurücktastete, als der einzig wahren Heimat des Erdlings Mensch. Mit der Hoch-Renaissance befindet man sich ja mitten drin im Zeitalter der großen Entdeckungen: Eine Neue Welt wurde damals nicht nur von Kolumbus entdeckt; allerwärts enthüllten sich ungeahnte Fernen und Fremden; ja seit Kopernikus und Giordano Bruno begann sich der Himmels-Globus in die Unendlichkeit des Weltalls auszudehnen. Der Mensch fühlte sich als eine Mitte von Mut und Macht, als kleiner Gott dieser Erde, die es rundherum zu erobern, sich anzueignen galt, auch in der Kunst. Denn hier wie nirgendwo sonst war eine höchste Steigerung der schöpferischen Kraft zu erleben, und man feierte die „creatività“ als einzigartige, gottgleiche Auszeichnung des Menschen. Allen Ernstes hat der Renaissance-Künstler anscheinend den Anspruch erhoben, mit seinem Werk Gottes Schöpfung überbieten, das Naturvorgegebene vervollkommnen zu können. Er verwirklichte in Stein und Farbe ein Ideal des Menschen von übermenschlicher Schönheit und Hoheit und erzwang damit die Bewunderung eines ohnedies bewunderungssüchtigen Publikums für diese gottgleichen Übermenschen, die mehr und mehr den zuvor von der Gottheit eingenommenen Platz besetzt haben. Dürers Apostelfürsten in der Münchener Alten Pinakothek blicken aus einer Höhe geistiger Giganten auf den Durchschnittsmenschen hinunter. Die Figur Gottvaters in der „Sixtinischen Kapelle“ Michelangelos erzeugt kaum größere „terribilità“ als seine Sybillen und Propheten und sonstigen menschlichen Giganten aus dem Alten Testament, seinem herkulischen Christus des „Jüngsten Gerichts“ stehen die Geretteten und Verdammten an einschüchternder Kolossalität allenfalls geringfügig nach. Raffael hat in der „Disputà“ die geistliche Majestät der Kirchenväter und Theologen auf nahezu die gleiche Stufe wie diejenige Christi gehoben, und in seiner „Schule von Athen“ ist die Geist-Größe des Menschen von ihm glorifiziert worden wie wohl nie zuvor und seither. Und in ihren Madonnen-Bildern haben Leonardo und Raffael Mutterlieblichkeit und Mutterseligkeit von im Übrigen ganz irdisch aussehenden Frauen mit so viel Innigkeit, Anmut und unwiderstehlichem Liebreiz verklärt, dass ihnen die höchste Bewunderung aller Zeiten für immer gesichert erscheint. War in der Religions-Geschichte des Mittelalters der Vater-Gott vermittels des Sohn-Gottes zunehmend menschlicher geworden, woraus sich zwangsläufig eine stetig gewachsene Wertschätzung des Menschen ergeben hatte, so ist es in der Renaissance zu einer Art Vergöttlichung des Menschen gekommen, die gewiss nur kurze Zeit anhielt – bereits mit Michelangelos Spätwerk ist sie zu Grabe getragen worden. Doch war damit unverkennbar eine tiefgefühlte Verwandtschaft mit dem Ideal des antiken Menschen bekundet worden. Denn die höchste Entfaltung der Kunst in der attischen Tragödie hatte es schon einmal gewagt, den edlen Menschen schier über seine Götter zu erheben, nachdem die anthropomorphe Gestaltung der Götter-Skulpturen in der Nachfolge Homers dies verwegene Vorhaben seit langem begünstigt hatte. Das tragische Erschrecken über solch arrogante Maßlosigkeit des Menschen ist in der Renaissance-Kunst dann von Shakespeare nachgeliefert worden. Doch selbst dadurch hatte die Erden-Wirklichkeit nichts vom ihr neu zugemessenen singulären Wert eingebüßt; sie blieb trotz der Düsternisse und Schatten, die schwer wieder auf sie fielen, die zurückgewonnene, einzige Heimat des Menschen, die nicht länger an einer ausgedachten, jenseitigen Vollkommenheit gemessen und unausbleiblich dadurch zur Nichtigkeit verurteilt wurde, sondern deren Wesen und Wandel durch die Kunst überschwänglich zu erhöhen und zu vollenden getrachtet worden ist, so dass, was sie metaphysisch transzendierte, nicht länger entbehrt wurde. Und so hat sich der Mensch für eine kurze, glückliche Zeitspanne als Herr und Gott in dieser schönen neuen Welt fühlen können, die er in Marmor und Farbe aus eigenem Vermögen geschaffen hatte, scheinbar für die Ewigkeit. Leichtfertig hat er sich wohl zu allen Zeiten in seinem angestammten Größenwahn, besonders mit den in Stein gebauten oder aus Stein gehauenen Kunstwerken, über seine hinfällige Endlichkeit hinwegzuhelfen versucht und ihre künstliche, nach seinen geistigen Maßen und physischen Bedürfnissen geschaffene Vollkommenheit für das wahre, der Gottesschöpfung oder der vorgebenden Natur überlegene Wesen der Wirklichkeit angesehen – es wird zahlreicher Rückschläge und verheerender Erfahrungen, zumal derer in den katastrophalen Weltkriegen des 20. Jahrhunderts bedürfen, bis der Mensch aus diesem Wahn einigermaßen ernüchtert wieder zu erwachen vermochte. Vollständig wird ihm das wohl kaum je gelingen können, diese heillose Selbsttäuschung gehört anscheinend zu seiner Naturausstattung und ist wohl einem elementar-instinktiven Bedürfnis nach physischer wie geistiger Daseinssicherung geschuldet.
Aber wunderbarer als in diesen zwei, drei Jahrzehnten um die Wende des 15. zum 16. Jahrhundert von den Künstlern in Florenz und Rom ist dieser Traum vom schöpferischen, quasi gottgleichen Menschen wohl niemals geträumt worden, allenfalls zur Zeit der klassischen Antike im Griechenland des Perikles. Und aus der Vielzahl der Genies, die diese phantastische Blütezeit des Menschengeschlechts hervorgebracht hat, strahlt der Ruhm eines Dreigestirns am hellsten und unvergänglichsten, auf deren Meisterwerke, sparsamst ausgewählt, ich mich daher vornehmlich beschränkt habe: Michelangelo, Leonardo und Raffael. In der Epoche ihres Schaffens hat ohne Frage Italien der Preis eines geistig-kulturellen Zentrums zumindest der abendländischen Welt gebührt.
Dabei sollte sogleich klargestellt sein, um dies Missverständnis, das durch die bisherigen Ausführungen nahegelegt erscheinen könnte, von vornherein auszuschließen, dass die Künstler der Renaissance allesamt, die drei genannten eingeschlossen, durchaus den Traditionen des Christentums verhaftet geblieben sind. Sie waren alle miteinander keine abtrünnigen Heiden, so verstanden, wäre die Bedeutung des Wortes von der Wiedergeburt der Antike, mithin des Heidentums verkannt. Savonarola hat die „Venus“ Botticellis missbilligt, wegen ihrer Nacktheit und der weltlichen Gesinnung, die sich mit diesem Werk erneut Ausdruck geschaffen hatte, so wie der Künstler als bekehrter Anhänger des glühenden Jenseitsfanatikers später seine früheren „heidnischen“ Bilder selber verurteilt hat, nicht jedoch, weil er geglaubt hätte, mit der meergeborenen Venus sei eine heidnische Göttin zu neuem Leben erwacht und Botticelli hätte dergleichen geglaubt: Niemand hat vor solcher Venus oder einer anderen mythologischen Gestalt der Renaissance-Kunst verehrend und anbetend die Knie gebeugt. Allenfalls wäre beim geistig freien und souveränen Leonardo von einer gewissen überlegenen Haltung kühlen Verschweigens der Religion zu sprechen möglich, Michelangelo und Raffael dagegen dürften als gläubige Christen durchgehen, wie ebenfalls die zahlreichen anderen Renaissance-Meister: Sie alle haben ganz konventionell im Auftrag der Kirche ihre Kunstwerke geschaffen, keineswegs autonom, und ihr Oeuvre umfasste überwiegend christlich-religiöse Themen. Im Falle Michelangelos wäre allerdings einschränkend hinzuzufügen, dass von ihm Figuren aus dem Alten Testament bevorzugt wurden: Zur Kreation der gewaltigen Recken des Geistes, zu deren Apotheose ihn sein Menschheits-Ideal bewog, haben sich ihm die alten Patriarchen und Propheten wohl als die geeigneteren Modelle angeboten. Im Hinblick auf Leonardo und Raffael, die mit ihren Werken der anmutig-edlen menschlichen Schönheit huldigten und diesem Ideal vor allem mit ihren unvergleichlichen Madonnen-Bildern Gestalt verliehen haben, ließe sich allenfalls konstatieren, dass sie, zumal Leonardo, bei ihren Gottes- und Heiligenbildern mit den üblichen Zugaben christlicher Symbolik, wie Kreuzen, Heiligenscheinen usw., recht dezent umgegangen sind: Überwiegend haben sie ihre Begeisterung und Kunst dem Dienst an der diesseitig irdischen, aber verklärten Schönheit der Frau und Mutter gewidmet, mag dazu auch ganz traditionell Maria als Sujet gedient haben, und die ist von ihnen wohl kaum in ketzerischer Absicht gemalt worden. Alle miteinander waren das keine Heiden oder gar Atheisten, vielleicht nicht einwandfrei kirchenfromm, der einzige Leonardo ist allerdings wohl kaum wirklich religiös gewesen. Im Übrigen ist davon nichts publik geworden, denn das wäre ihnen wahrlich schlecht bekommen. Zu einem öffentlich bekannten Atheismus war die Zeit noch lange nicht reif, die Kirche nach wie vor fast allmächtig, und von ihren Aufträgen im Dienste der Propaganda des christlichen Glaubens hat der Künstler schließlich weitestgehend gelebt.
Gleichwohl hat sich mit den Werken der Renaissance-Künstler etwas anderes, etwas Neues angekündigt, dem die Zukunft gehörte, in der Gott endgültig sterben würde; wo sich der Mensch für eine kurze Weile angemaßt hat, sich an seine Stelle zu setzen; aber alsbald und unwiderruflich aus diesem Wahn wieder erwachte; sich nachgerade, gänzlich auf sich allein gestellt, als ein endliches, ephemeres Wesen wieder entdeckte, ein Spiel von Notwendigkeit und Zufall wie alle übrigen Erdenwesen; das aber als einziges mit einem gewissen Stolz seine Sache in die eigenen Hände nehmen konnte, da ansonsten niemand mehr in Sicht war, der ihm diese schwierige, allemal nur provisorisch zu lösende Aufgabe seiner geistigen Existenz hätte abnehmen können.
Doch ein erstes Mal, wie ich es sehen möchte, im Jahre 1504, als Michelangelo (1475-1564) seinen „David“ vollendete, war der Mensch spektakulär und gottgleich von ihm auf den höchsten Thron gehoben worden. Der um 23 Jahre ältere Leonardo (1452-1519) schuf seine Meisterwerke, auch die „Anna Selbdritt“ (1508-1510), die ich eingehender behandeln möchte, mit Ausnahme des Mailänder „Letzten Abendmahls“, erst etwas später. Der viel jüngere Raffael (1483-1520) („Madonna della Sedia“, 1513/14) war beider Schüler; Giorgione (1478-1510) ist ohne Leonardo undenkbar („Ruhende Venus“, um 1510). Tizians (1477-1576) „Venus“ von 1536, die schon nicht mehr in die kurze Epoche der Hoch-Renaissance hineingehört, die etwa mit dem Tod Giorgiones und Raffaels zu Ende gegangen war, oder gar das zusätzlich herangezogene Selbstbildnis Rembrandts (1606-1669), der überhaupt kein Renaissance-Maler mehr gewesen ist, dienen nurmehr zur abschließenden Verdeutlichung der vorgenommenen Deutung der drei überragenden Renaissance-Künstler und ihrer bedeutendsten Werke.
Also zuerst Michelangelos „David“ (1501-1504)! (Abbildung) Die über vier Meter große, kolossale Statue eines nackten Jünglings wirkte wie ein Fanal, das den Beginn einer neuen Epoche ankündigte. Der Eindruck auf die Zeitgenossen war enorm, zusammen mit der vorher in Rom geschaffenen „Pietà“ (1498/99) ist mit dem „David“ der Ruhm Michelangelos fest begründet gewesen: Die Antike schien wahrhaftig wiedererstanden zu sein. Man bedenke: Seit den Anfängen des Christentums, also seit über einem Jahrtausend, hatte es im Abendland keine nackten Monumental-Statuen mehr gegeben! Die überkommenen antiken Götter-Standbilder hatten das verhindert: Man fürchtete ihre faszinierende Konkurrenz und hatte sich vor ihrer irritierenden Sinnlichkeit und Körperlichkeit in die Sphäre des Welt überwindenden Geistes geflüchtet. Die Nacktheit, wo sie überhaupt in der christlichen Kunst noch vorgekommen war, bei Adam und Eva etwa oder der Auferstehung der Verstorbenen am Jüngsten Tage, ist eher als Ausdruck erbarmenswürdiger Kreatürlichkeit gemeint gewesen denn als Wert in sich: Signum stolzer und schöner Leiblichkeit. Wohl hatte es vor Michelangelo bereits zaghafte Bemühungen in derselben Richtung gegeben, etwa Nicola Pisanos „Herkules“ an der Baptisteriums-Kanzel im Dom zu Pisa aus dem Jahre 1260: eine gedrungene, kleine Gestalt, nicht einmal freistehend, Schmuck der Kanzel zusammen mit anderen Figuren. Imponierender war da schon der unvergleichliche Bronzeguss von Donatellos „David“ gewesen (1430-1432), (Abb. 43) voll freistehend, in der göttlichen Nacktheit knabenhafter Anmut dargestellt, nur mit phantastischem Hut und ornamentgeschmückten Beinschienen bekleidet, wodurch die Nacktheit nur noch gesteigert erscheint: das ruhmvolle Meisterwerk eines genialen Künstlers. Doch im Vergleich zum gigantischen „David“ Michelangelos war derjenige Donatellos von zierlicher Winzigkeit gewesen. Sicherlich ist durch diese bezaubernde Figur für Michelangelo der Boden bereitet worden, aber die Früchte des Starruhms und immenser Popularität hat erst er für seine kolossale Gestaltung desselben Themas geerntet. André Malraux hat, meine ich, das erlösende Wort dafür gefunden, was geschehen war: Die ehrfürchtige Demut des kreatürlichen Menschen vor seinem erhabenen Schöpfergott war dem Stolz auf Größe und Freiheit des durch Tat und Werk schöpferischen Menschen gewichen. „Den Heiligen, die den Heros nicht kannten, waren die Propheten gefolgt; diesen folgt nun der für sich alleinstehende Heros, der sich Gott entzieht, wie er sich der Kirche entzieht“ (André Malraux: Propyläen Geist der Kunst. Metamorphose der Götter, II. Bd: Das Irreale, S. 91). Dass es im Falle Donatellos wie Michelangelos noch ein religiöser Heros gewesen ist, der dargestellt wurde, spricht für die oben vorgebrachte Behauptung, dass man sich noch ganz selbstverständlich im Bannkreis von Religion und Kirche bewegte. Doch unterschwellig hatte man sich, in Folge eines neuen Lebensgefühls, von einem Glauben, dem am Diesseits und dessen eigenem Wert nichts liegen konnte und ebenso wenig an geistiger Größe und ureigener Kreativität des Menschen, euphorisch abgewendet. Im Übrigen gab David den einzigen Heros der Bibel ab, der überhaupt in Frage kam, wenn etwas wie kriegerischer, selbstgewisser Mannesmut gerühmt werden sollte. Die Figuren des Neuen Testaments machten da an sich nicht viel her, das waren lauter Arme im Geiste, Provinzler und Entrechtete, ohnmächtig, ohne stolzes Selbstbewusstsein. Gleichwohl sind in der Renaissance selbst diese Erniedrigten und Beleidigten maßlos heroisiert worden, doch dann sollte wohl eher, so man nicht die Standhaftigkeit der Märtyrer gepriesen hat, an ihre Geistesmächtigkeit gedacht werden – erwähnt hatte ich bereits das Beispiel von Dürers vier Apostelfürsten, bei Behandlung von Michelangelos „Moses“ ist grundsätzlicher darauf zurückzukommen. Selbst die überraschende Nacktheit „Davids“ hat noch nicht das Entscheidend-Neue und Bedeutungsvolle ausgemacht, sondern dafür muss die wiedergewonnene, alle obligate christliche Entfremdung von der Erde überwindende, der antiken vergleichbare Lust am sinnlichen Erdenleben gelten, das ungewohnte Credo von der Schönheit der Welt und der Größe des Menschen, die erfrischende Befreiung von der geglaubten Kreatürlichkeit wie von einem Makel. Wie Michelangelo seinen Christus als nackten Heros vorgestellt hat, mag heute nachgerade peinlich wirken. Seine ungezügelte Bewunderung und Verherrlichung des nackten, besonders jugendlich männlichen Körpers, hatte etwas Pathologisches an sich und hing mit seiner wohl unbestreitbar homosexuellen psychischen Konstitution zusammen. Will man treffender nachvollziehen, was Malraux mit Heros gemeint hat, der bewundert wurde, und der dem Heiligen gefolgt war, den man verehrt hatte (vgl. S. 93), sollte man sich ratsamer etwa die Reiterstatuen des „Gattamelata“ von Donatello (1447-1453) oder des „Bartolomeo Colleoni“ von Verrochio (1479-1488) (Abb. 44) in Erinnerung rufen – das waren keine Helden der Bibel mehr, und sie sind auch nicht nackt dargestellt. Vielmehr handelt es sich um Denkmäler verwegener Eroberergestalten, profaner Männer der Tat und dazu des blutigen Krieges, und im Übrigen – bei Licht besehen – um Figuren von überaus zweifelhafter moralischer Statur, ja gewalttätigst krimineller Energie. Die Künstler der Renaissance haben – gut dafür bezahlt – in solchen Meisterwerken der großplastischen Kunst denselben schönen Traum männlicher Machtfülle und kriegerischen Wagemuts, allerdings auch überragender geistiger Energie geträumt, wie ihn die griechische Kunst mit den Götterstatuen oder Rom mit seinen Cäsaren vorgeträumt hatte: Obzwar keine Götter mehr, wirken sie zu wahrhaft übermenschlicher Größe gesteigert, begeistert und begeisternd soll mit ihnen das Ideal machtvoll tüchtiger Persönlichkeiten schön vor aller Augen gestellt werden, die Ehre und Würde ihres Standes und Berufes vorbildlich repräsentierten. Das Empirisch-Menschliche erscheint hier zu einem Übermenschlichen, Quasi-Göttlichen, jedenfalls ungemein Eindrucksvollen und Bewundernswerten verklärt worden zu sein, in einem überwältigenden Hymnus auf die stolze Größe des Menschen, der sein eigener Herr und sein eigenes Schicksal ist und keinen Gott über sich mehr braucht.
Vielleicht lässt sich das am Beispiel von Michelangelos „David“ – exemplarisch gemeint – noch etwas verdeutlichen.
Schon die Vorgeschichte dieser berühmtesten Statue ist aufschlussreich. Seit mehr als 30 Jahren hatte im Hof der Dombauhütte von Florenz ein riesiger, über vier Meter hoher Marmorblock herumgelegen, aus dem die Skulptur eines Schutzheiligen der Stadt zur Bekrönung eines der äußeren Strebepfeiler von „Santa Maria del Fiore“ gemeißelt werden sollte. Zwei Künstler hatten sich im Auftrag der Dom-Opera an der Arbeit versucht, waren aber gescheitert und mussten den Block unverrichteter Dinge liegen lassen. Selbst Leonardo soll das an ihn ergangene Ansinnen abgelehnt haben, aus dem verhauenen Stück Stein noch etwas Ansehnliches zu machen. Erst Michelangelos an den Vatikanischen Antiken geschulte Augen entdeckten die Möglichkeit, aus dem ungefügen Klotz ein seinen eigenen Ansprüchen und denen seiner Auftraggeber genügendes Kunstwerk zu schaffen. Er erhielt den Auftrag und verfertigte in etwas mehr als den vereinbarten zwei Jahren – genau in 28 Monaten –, was in Florenz danach nur noch „il gigante“ genannt wurde. Und als das vollendete Werk der staunenden Öffentlichkeit vorgeführt wurde, ist anscheinend sofort allen Beteiligten klar gewesen, dass sein Platz nicht länger, wie in romanischen und gotischen Zeiten, vor einer Kirchenwand sein konnte, überhaupt vor keiner Kirche mehr. Eine Kommission von ungefähr dreißig verdienten Florentiner Bürgern, darunter bekannteste Künstler wie Leonardo und Botticelli, Perugino und Filippino Lippi, wurde bestellt, um den geeigneten Ort zur Aufstellung der freistehenden Rundplastik zu finden. Am Ende hat man sich, was wohl auch Michelangelos Wunsch entsprach, für einen Platz vor dem Eingang zum „Palazzo Vecchio“ auf der prächtigen „Piazza della Signoria“ entschieden, also für die Jedermann zugängliche, profane Öffentlichkeit, für ein Symbol des Bürgerstolzes, des Lebensmutes und des Selbstbewusstseins der Stadt.
In der christlichen Theologie galt David als großmächtiger Vorläufer Jesu Christi: Wie David seinen Riesen, so hatte Christus Tod und Teufel besiegt. Schließlich war der alttestamentliche König zum allgemein anerkannten Sinnbild von Mut und ritterlicher Tapferkeit aufgestiegen, unter dessen Schutz sich die Stadt Florenz gerne gestellt sah. Aus der Bibel hatte man parteiisch herausgelesen, was einem frommte: Das frische Gottvertrauen des körperlich unterlegenen, aber kecken und mutigen Jünglings, der, nur mit der Hirtenschleuder bewaffnet, dem überheblich prahlenden und mit schwerer Bronzerüstung wohl geschirmten Riesen Goliath in scheinbar aussichtslosem und ungerechtem Zweikampf entgegengetreten war und mit Gottes Hilfe den stärksten Krieger der gefürchteten Philister gefällt hatte. Selten ist sich darüber Rechenschaft gegeben worden, dass die zur Rühmung des bedeutendsten Königs Israels aufgetischte Geschichte, so sie denn auf Tatsachen beruhen sollte, in Wahrheit die Unfairness im Kampfverhalten der beiden Gegner völlig zu Gunsten Davids verdreht hat: Der Philister, einem Volke indoeuropäischer Herkunft entstammend, forderte – wie anderwärtig öfters überliefert, beispielsweise in der „Ilias“ und bei der frühen Eroberung Griechenlands durch die sogenannten Herakliden – im angetragenen Zweikampf ein Gottesurteil heraus, damit ein allgemeines Blutvergießen vermieden werden könnte. Im Falle der Niederlage im Zweikampf war es Gepflogenheit, mit heiligen Eiden die kampflose Unterwerfung des eigenen Volkes zu versprechen. Von dem semitischen Hirtenjungen, der von solch ritterlicher Sitte, wie offenbar sein ganzes Volk, nichts wusste und begriffen hat, ist der Gegner mit der Steinschleuder folglich aus der Ferne zu Tode getroffen, also mit einer Waffe getötet worden, der er nichts entgegenzusetzen hatte, und die er als Fernwaffe wie Pfeil und Bogen als unmännlich und unehrenhaft bei solchem Zweikampf verschmähte: Er war ja mit Speer, Schwert und Schild bewaffnet, wie die homerischen Helden vor Troja fast durchweg, die den mutigen, ruhmvollen Nahkampf Mann gegen Mann suchten. Für die Israeliten in ihrem Heldenepos war davon nur ein dummer, ungeschlachter Prahlhans übrig geblieben sowie der heldenhafte Sieg eines der Ihrigen, gar eines Knaben oder Jünglings, des späteren größten Kriegsherrn und berühmtesten Königs ihrer Geschichte, Inbegriff eines überlegenen Geistes und Gott vertrauender Tapferkeit. Dass derart Gott unversehens zum Helfershelfer eines im Grunde gemeinen Totschlägers und auch im Verlauf seines tatenreichen späteren Lebens mehr als zweifelhaften Charakters gemacht worden war, ist dabei völlig ausgeblendet geblieben, allein der Erfolg zählte, und hat selbstverständlich auch für Michelangelos Auffassung Davids keinerlei Rolle gespielt. Im Gegenteil kann man davon ausgehen, dass der Künstler, wie ebenfalls in anderen seiner Meisterwerke – beim „Moses“ werde ich darauf genauer eingehen – mit dem „David“ seinem Traum- und Wunschbild machtvoller männlicher Tatkraft Gestalt verschaffen wollte, einem Hochbild auch seiner eigenen jugendlich-machtvollen Schaffenskraft und genialen künstlerischen Intelligenz: das Denkmal des triumphalen Sieges eines souveränen Geistes über die rohen, wilden Kräfte der Natur, im speziellen Fall womöglich im trotzigen Aufbegehren gegen die Gewaltherrschaft der Medici, denen er doch in seinen Anfängen alles zu verdanken hatte. Zumindest haben die freiheitsliebenden Florentiner Bürger den „David“ sogleich als Symbol eines gottbeglaubigten Sieges über alle Tyrannei verstanden und sich damit anscheinend im Einverständnis mit dem Künstler gewusst. Denn auf der Skizze zu einem verlorengegangenen „Bronze-David“ Michelangelos, wohl einer Kopie desjenigen von Donatello, zu dem ihn die Stadt während der Arbeit an seinem „Marmor-David“ angehalten hatte, fanden sich laut Überlieferung die stolzen Worte geschrieben: „David mit der Schleuder und ich mit dem Bogen“ – mit dem Bogen könnte ein wichtiges Werkzeug des Steinmetzen gemeint gewesen sein oder auch die Waffe eines apollogleichen Geistes, der sein Ziel sicher trifft.
Doch wie dem auch gewesen sein mag, Michelangelo war mit der „David-Statue“ ein bis heute populär gebliebenes Bildnis des heroischen Menschen geglückt, in dem sich der neue Menschheitsglaube der Renaissance rühmlich wiedererkennen konnte. Die Nacktheit der Statue, die an der ungemeinen damaligen Wirkung gewiss einen beträchtlichen Anteil hatte, ergab sich hier wie beiläufig und ungezwungen und konnte kaum Protest erregen: In der Bibel war ja ausdrücklich berichtet worden, David habe Sauls ungewohnte Rüstung wieder ausgezogen, bevor er in den Kampf mit Goliath zog. Natürlich wäre dabei nicht an die völlige Nacktheit eines griechischen Olympioniken zu denken gewesen. Die Israeliten haben sich in dieser Hinsicht eher prüde gegeben, wie die Geschichte von Adam und Eva dokumentiert, wo die beiden sich nach dem Sündenfall ihrer Nacktheit schämten und sich einen Schurz aus Feigenblättern machten, den Gott praktischerweise durch Röcke aus Fell ersetzte – vermutlich sollte damit g’schamig auf die natürliche Behaarung angespielt werden. Auch Ham, Sohn Noahs, der seines weinberauschten Vaters Blöße sah, wurde dieserhalb verflucht usw. Michelangelo dagegen hat mit seinem nackten „David“ eindeutig und unverhohlen in das hohe Preislied der Antike auf den schönen, besonders männlich menschlichen Körper eingestimmt – bei ihm wird das nachgerade zur Obsession, die ihn beispielsweise noch die allermeisten Heiligen und Kirchenfürsten des „Jüngsten Gerichts“ in der „Sixtina“ mehr als 32 Jahre später nackt darstellen ließ, wo es einigermaßen deplaziert wirkt. Auch Christus, als fast nackter Herkules oder Apollo gebildet, mag sich heutzutage eher befremdlich ausnehmen. Doch im Florenz des beginnenden 16. Jahrhunderts muss diese riesige Statue einer nackten Athletenfigur, vor aller Augen auf dem zentralen Platz der Stadt aufgestellt, geradezu sensationell gewirkt haben, ist alsogleich zum Identifikationsobjekt der Bürger geworden und hat wohl zu deren ungemeinem Stolz und Selbstbewusstsein beträchtlich beigetragen. Vermutlich war das besonders der neuartigen Auffassung der Figur durch Michelangelo geschuldet. Sein „David“ ist nicht mehr – wie herkömmlicherweise und auch noch bei Donatello, seinem berühmtesten Vorgänger – nach getaner Tat wiedergegeben worden, das mächtige Haupt des gefällten Riesen zu Füßen, sondern Michelangelos Held rüstet sich erst zur mutigen Tat – und fortan konnte sich ein jeder Florentiner, durch die packende Gestaltung dazu animiert, in die gleiche tapfere Entschlossenheit und Siegesgewissheit vor einer schier unlösbaren Aufgabe hineinwünschen. Der „David“ Michelangelos geht über zum tödlichen Angriff. Der Kopf ist gespannt dem Feinde zugewendet, die Augenbrauen zusammengezogen. Messend mitleidslos späht der Blick nach der Blöße des Gegners, alles bezeugt den kühnen, selbstsicheren Willen zu Kampf und Sieg. Angespannt bis zum Äußersten vibriert der gesamte Körper von der noch verhaltenen Bewegung, die sogleich zum Ausbruch kommen wird. Der linke Fuß berührt kaum noch den Boden, das Bein ist bereits gebeugt, die linke Hand greift zur Schleuder, die rechte nach dem Stein in der Tasche. Noch ruht die geballte Kraft fest auf dem rechten gestreckten Bein wie auf einer unerschütterlichen Säule, noch hängt der rechte Arm untätig zur Seite. Aber die angeschwollenen Sehnen und angespannten Muskeln bestätigen die Bereitschaft, im nächsten, geeigneten Moment blitzschnell zuzugreifen und den todbringenden Stein gegen den unachtsamen Gegner zu schleudern. Alles verrät den geistklaren, unbeugsamen Willen und die siegesgewisse Glaubenszuversicht Eines, der Gott zu seiner Rechten weiß (vgl. Psalm 16.8). Die Blöße des prahlenden Feindes, sobald sie sich zeigt, wird er blitzschnell und erbarmungslos ausnutzen und ihn ruhigen Gewissens abschlachten. Daher konnte Michelangelos „David“ sogleich zum überredendsten Sinnbild eines idealen Kämpfers für die Freiheit werden. Er stellte die vollkommene Verkörperung des gottgleichen Heros der Renaissance dar, seiner virtù, vorbildlicher männlicher Selbstmächtigkeit. Solchermaßen konnte er zum hinreißenden Symbol für den Freiheitswillen, für Selbstachtung und Souveränität seiner Florentiner Mitbürger werden, er trat ihnen sozusagen als ein neuer Adam vor Augen, geschaffen nicht mehr von Gott, sondern von einem Menschen und jeden dazu auffordernd, sich ebenso selbst zu schaffen und allen Widrigkeiten stolz und siegessicher die trotzige Stirn zu bieten wie dieser „David“. Wahrhaftig schien die Antike wiedererstanden zu sein, mit der selbstbewussten Nacktheit des gottgleichen Menschen war sie strahlend von neuem ans Licht des Tages getreten nach der langen, finsteren Nacht des Mittelalters – und doch, welch Unterschied zu den griechischen Götterstatuen! Gewiss, die unschuldige, marmorweiße Nacktheit hatte sie in der Tat ihnen zu verdanken, auch den vollendeten Kontrapost, die anatomisch richtige Durchbildung des Körpers, überhaupt das unerhörte Gelingen einer gänzlich freistehenden Monumental-Statue nach einem Interregnum von mehr als einem Jahrtausend. Doch gegenüber antiker Typik hob sich weltenfern die naturalistische Gestaltung der Figur ab, ihre unverwechselbare Individualität und unbändige seelische Dynamik, die sich in der gesamten Körperbehandlung offenbarte! Unwiderstehlich erschien hier ein Inneres nach außen vorgetrieben zu sein, tat sich unverhohlen kund, ein Individuell-Geistiges, das trotz aller Beachtung und Betonung des Körperlichen das Eigentliche war. Vielleicht lässt sich am ungezwungendsten, was mit dieser Behauptung einer neuartigen Realistik gemeint sein soll, einer Deutung entnehmen, die sich zuerst wohl bei Herman Grimm angedeutet fand (Das Leben Michelangelos, S. 599) und danach vom berühmten Heinrich Wölfflin in seiner „Klassischen Kunst“ ausgeführt wurde, der drastisch von einem „riesenmäßigen Kerl in den Flegeljahren“ gesprochen hat. Bei Grimm las sich das noch etwas dezenter: „Keine (der griechischen Arbeiten, d. Verf.) wird gefunden werden, welche wie bei David einen so starken, fast dicken Kopf mit so schlanker, fast schmaler Gestalt, und dann wieder so großen Händen und Füßen verbindet. Die Natur lässt eine solche Zusammenstellung von Widersprüchen zu. Gerade dieses Nebeneinander von Plumpheit und Leichtigkeit kennzeichnet ein gewisses Alter, und Michelangelo konnte, wenn er David hinstellen wollte, wie ihn die Bibel beschreibt: Ein Knabe und Held zugleich, ein Hirtenjunge, mehr gewandt als stark, einem Pferde vergleichbar, das das Fohlenhafte in seinen Gliedern noch nicht verloren hat, ihn nicht charakteristischer geben, als er getan hat.“
Trotz solch unübersehbarer Disproportionalitäten im Einzelnen ist der „David“ von der Florentiner Bürgerschaft unbeirrt als Garant eines gottgewollt rechtmäßigen Sieges ihrer überlegenen Geistigkeit über alle Feinde des Vaterlands adoptiert worden, und die Popularität der Figur ist seither ungebrochen geblieben, noch heute mag sie manchem Betrachter zum überzeugenden Sinnbild für Kampf und sicheren Sieg der Freiheit über alle Willkürherrschaft geraten. In jedem Fall war es Michelangelo in spektakulärer Manier gelungen, ein Identifikationsgefäß für alle Großmannsträume des Renaissance-Menschen bereitzustellen, zumindest für seine eigenen. Mit einer geradezu manischen Einseitigkeit hat er danach ein ganzes Geschlecht von menschlichen Giganten geschaffen, auch Christus vermochte er sich nur noch so vorzustellen: Dieser unterschied sich kaum mehr von den heroischen Menschenfiguren, die allesamt ins Gewaltige, Kolossale, Übermenschliche, Quasi-Göttliche gesteigert erscheinen, mit fließenden Grenzen zu Gestalten, die allerhöchsten Ansprüchen an menschlicher Schönheit und Würde genugtun konnten. Daher mögen sie vom dafür Empfänglichen noch heute für Hochbilder menschenmöglicher Selbstherrlichkeit genommen werden und zum Vorbild von Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung dienen können. Denn Michelangelo hat, wie die Renaissance-Künstler allesamt, in seinem Werk zwar Individuelles gestaltet und gefeiert, aber es ebenso unbedingt ins Ideale erhoben, zu anmutiger Schönheit anfangs seiner Laufbahn verklärt und zu menschlicher Größe bis zum Ende seines Schaffens. Nirgends in seinen Werken war bloß Portraithaftes intendiert. Wie haben Moses und David, Christus und Maria, die Propheten oder die Apostel oder die Medici im Fleisch ausgesehen? Offensichtlich hat das Michelangelo überhaupt nicht interessiert. Ihnen allen hat er eine seinem Ideal von höchster Schönheit und Würde angemessene Gestalt anerschaffen und sie ins Übermenschliche erhöht. Als er einmal anlässlich der jugendlichen Maria seiner „Pietà“ getadelt wurde, die kaum älter wirkt als der Sohn in ihrem Schoß, beide dazu über alle Maßen schön, wie es ihm später niemals mehr geraten ist, vielleicht aber auch wegen der Glattheit, ja Süßlichkeit derartiger Schönheit nie mehr von ihm erstrebt wurde, soll er sich – einigermaßen pseudopsychologisch und pseudotheologisch – folgendermaßen gerechtfertigt haben – zumindest hat es sein Biograph Condisi so kolportiert: „Weißt du nicht ..., daß keusche Frauen sich viel frischer erhalten als die, welche das nicht sind? Um wieviel mehr aber eine Jungfrau, welcher sich niemals die geringste sündhafte Begierde in die Seele verirrte! Aber noch mehr, wenn eine solche Jugendblüte auf die natürlichste Weise schon in ihr erhalten blieb, so müssen wir glauben, dass die göttliche Kraft ihr noch zu Hilfe kam, damit der Welt die Jungfräulichkeit und unvergängliche Reinheit der Mutter Gottes um so deutlicher erschiene … Deshalb darf es dir nicht wunderbar erscheinen, wenn ich die heiligste Jungfrau und Mutter Gottes … viel jünger darstellte, als die Rücksicht auf das gewöhnliche Älterwerden des Menschen verlangt hätte“ (zit. Grimm, S. 171).
Sollten diese Worte authentisch auf Michelangelo zurückgehen, mag man sich einerseits über die darin zum Ausdruck kommende naive Gläubigkeit des Meisters wundern; aber andererseits darf auch wohl auf den maßlosen Stolz des Schöpfers einer Figur zurückgeschlossen werden, dem es mit seinem Werk gelungen schien, die überirdisch unvergängliche Reinheit und Schönheit der Gottesmutter so berückend allen vor Augen zu stellen, dass Gott selber es nicht besser hätte machen können. Denn leider hatte der nur in vergänglichem, zuletzt alterndem und verwesendem Fleisch gearbeitet, er dagegen im „ewigen“ Stein. Etwas von solcher Selbstüberhebung und hybriden Maßlosigkeit kommt unverhüllt zum Ausdruck, als die fehlende Ähnlichkeit von Gestalt und Gesicht seines Giuliano Medici vor Michelangelo gerügt wurde, den man ja noch als Lebenden gekannt hatte, was er mit den Worten abgefertigt haben soll: „In fünfhundert Jahren wird man sein uninteressantes Gesicht vergessen haben“ (zit. André Malraux: Propyläen. Geist der Kunst, 2. Teil, 2. Bd.: Metamorphose der Götter, S. 132).
Michelangelo hat den Menschen, zu einem gewissen Teil wohl in Kompensation seiner eigenen körperlichen Unzulänglichkeiten, derartig ins Ungeheuerlich-Übermenschliche gesteigert, dass es auf seine Zeitgenossen erschreckend gewirkt hat. Wohl daher rührt die Rede von seiner berüchtigten „terribilità“ her, zusätzlich ist sie aber bestimmt auch Resultat seines ungehobelten, unberechenbaren, jähzornigen und störrischen Charakters gewesen sowie der wilden Besessenheit, mit der er seine Werke geschaffen hat.
Nirgends, glaube ich, hat er aber von der Ungeheuerlichkeit seines Werkes und der darin symbolhaft zum Ausdruck gebrachten allgemeinen „terribilità“ des Menschen ein würdigeres Zeugnis hinterlassen als mit der berühmten Statue des „Moses“, (Abbildung) bestimmt für das grotesk überdimensional geplante und von Michelangelo nur sozusagen en miniature fertig gebrachte Grabmal Julius II., dem ebenfalls schon zu Lebzeiten „terribilità“ nachgesagt wurde. Möglicherweise lässt sich demnach von beiden Männern auch Persönliches in der „Moses-Statue“ wiederfinden, zumindest dürfte sich Michelangelo im Selbstbild des schöpferischen Künstlers ohnegleichen als ein solcher Recke des Geistes gefallen haben – es ist ihm gelungen, dies stolze Selbstbewusstsein eines quasi-göttlich schöpferischen Menschen, das ihm bereits von seinen Zeitgenossen fast aufgedrängt worden ist, zu ungeschmälerter Glorifizierung seiner Person als einer Art Heros der Kunst an die Nachwelt weiterzuvererben 1 –, doch vermag selbst solch überzogene Künstler-Vergöttlichung der Meisterschaft nicht den geringsten Abbruch zu tun, mit der in diesem Kunstwerk einer der wenigen ganz Großen der Menschheit bedeutsam gesehen und in Marmor verewigt worden ist.
Indes hatte Michelangelos Renaissance-Natur, als er seinen „Moses“ sozusagen gewohnheitsmäßig – man möchte meinen, er konnte gar nicht anders – ins Quasi-Göttliche steigerte, gegen einen eigentümlich jüdischen Zug der Moses-Gestalt verstoßen. Denn in diesem und fast nur in diesem Falle, in Tradition eines rigorosen Monotheismus, der vielleicht tatsächlich auf Moses als prominente Stifterfigur zurückgeht, ist die übliche Deifizierung eines der maßgeblichen Menschen vermieden worden. Weder Laotse noch Konfuzius noch Buddha und der Begründer der Jaina-Religion, noch der Pharao oder Jesus oder die griechischen Heroen sind diesem trüben Schicksal der Vergöttlichung entgangen, einzig und allein Moses. Gott soll ihn nach seinem Tode mit eigenen Händen begraben haben, die Grabstätte blieb unbekannt; keinerlei vulgäre Idolatrie hat sich an seine Gestalt zu knüpfen vermocht. Aufs Engste hing das natürlich mit der monotheistischen Religion zusammen, die mit seinem Namen untrennbar verbunden ist: den Erzählungen des von ihm inaugurierten Auszugs aus dem polytheistischen Ägypten, der langjährigen Isolierung in der Wüste mit strenger Einübung des Eingottglaubens sowie von Jahwes heiliger Gesetzgebung für das israelitische Volk, das so erst überhaupt geschaffen wurde, verschieden von allen anderen Völkern – die Geschichten von Adam bis Noah, von Abraham, Isaak und Jakob dürfen wohl als nachträglich erdichtete Vorgeschichte für diese Religions- und Volkstiftung durch Moses aufgefasst werden. Das grundlegend Neue dabei war die Moses verdankte Gottesvorstellung, der Glaube an einen einzigen, über alles Weltliche als seine Schöpfung unendlich erhabenen Geist-Gott sowie die Vorstellung vom Menschen als Gottes Ebenbild im Geiste, samt und sonders wie in eklatantem Gegensatz zu Ägypten erfunden: zahllose Götter dort, hier der Eine, Einzige; das Leben und Sterben des Menschen extrem auf ein todloses Jenseits bezogen, in den älteren Teilen der Bibel keinerlei Spur eines Glaubens an ein jenseitiges Leben; eine unabsehbare Fülle von Götter-Idolen, Tiergöttern und gottgleichen Pharaonen, dagegen rigides Bilderverbot und einzigartige Hochwertung von Wort und Schrift, die ihren nicht genug zu bewundernden Niederschlag im „Buch der Bücher“ gefunden haben. Weil aber solchermaßen der Geist-Gott Jahwe in einen schroffen Gegensatz zu aller Erdennatur geraten war, zum Ganz-Anderen wurde und einzig dem Menschen als Gottes Bild und Gleichnis eine Art Geistnatur zugebilligt werden konnte, hatte allein die Beziehung des Menschen zu seinem Schöpfer und absoluten Herrn religiöse Relevanz. Und nachgerade ist genau das der große Gedanke Moses’ gewesen, von weltgeschichtlicher Wirkung: Vor diesem erhaben Allerhöchsten sind alle Menschen gleich, alle dürfen sie als Kinder des einzigen Vaters gelten. Kein Pharao ist himmelhoch vor den anderen Menschen ausgezeichnet: Er, ein Gott, die anderen seine Sklaven – das ist frevelhafte, verdammenswerte Abgötterei, unverzeihliche Beleidigung von Gottes übergroßer Majestät. Daher erscheint die jüdische Bibel von einem leidenschaftlichen Kampfgeist gegen jedwede soziale Ungleichheit beseelt, natürlich allemal zur höheren Ehre Gottes gedacht, und zu ihrer Zeit haben die Propheten, Amos und Hosea, Isaias und Micha, groß fortgesetzt, was mit Moses groß begonnen hatte: Heilig sollte das Volk sein, wie sein Gott heilig war, und zwar restlos alle miteinander, ein Volk von Priestern sollte es sein (vgl. Exodus 19.6). Ohne Frage ist dies die Geburtsstunde eines der höchsten moralischen Ideale der Menschheit gewesen – wie immer eingeschränkt und vielfach außer Kraft gesetzt, dies Ideal im alten Israel in tatsächlicher Geltung gestanden hat, braucht hier nicht zu interessieren, genauso wenig wie der religiös begründete orientalische Untertanengeist. Und vielleicht ist dies Ethos in der Tat erstmals von Moses in solcher Reinheit gefordert worden, wie es erst sehr viel später ähnlich, aber nicht religiös begründet, vom antiken Griechenland als demokratisches Ideal formuliert worden ist – im Prinzip war damit die Idee der Selbstverwirklichung, die noch heute Gültigkeit hat, auf einen langen, dornigen Weg gebracht.
Und als diesen übergroßen – mag sein, nur mythischen – Begründer einer höchstrangigen sittlichen Idee, wenn auch in seinem Fall noch im selbstverständlichen Glauben an einen Gott verankert, der ihm das moralische Gesetz angeblich höchstpersönlich aufgeschrieben hatte, hat auch Michelangelo, bin ich überzeugt, seinen „Moses“ konzipiert und geschaffen. Und so mag der vom Künstler beabsichtigten bewundernden Identifizierung des Betrachters mit dieser Figur auch heute noch eine Wirkungschance vergönnt sein: ein Erlebnis von geistiger Größe, die dem Wunschtraum davon nachkäme, der den Künstler bewog hat, die Figur so und gerade so zu gestalten. Um aber Michelangelos „Moses“ als solchen Heros eines höchsten Ideals menschlicher Sittlichkeit beglaubigen zu können, genügte es, als verbindlichen Grundzug aller Moralität die Selbstüberwindung anzunehmen. Denn genau als ein solch überwältigendes Denkmal schier übermenschlicher, geistbestimmter Selbstbeherrschung und Selbstüberwindung hat Michelangelo seinen „Moses“, meine ich, konzipiert und als sein Meisterwerk im ewigen Marmor verwirklicht – Herman Grimm hat die gewaltige Gestalt wohl zu Recht als „Krone der modernen Skulptur“ bezeichnet (S. 379).
Der „Moses“ Michelangelos war, wie vorgemerkt, von Beginn an für das Grabmal Papst Julius II. gedacht, zusammen mit zahlreichen anderen Figuren, die nie zur Ausführung kamen, sollte er es schmücken. Bei der Minimalausführung des Grabmals in „San Pietro in Vincoli“, die zuletzt zustande kam, bildet er die alles Übrige absolut beherrschende Figur. Ein Kardinal von Mantua, wird berichtet (vgl. Grimm, S. 662), soll ausgerufen haben, da er als Begleiter von Papst Paul III. und sieben weiterer Kardinäle Michelangelo in seiner Werkstätte aufsuchte, wo der gerade am „Moses“ arbeitete, um den Fortschritt der Entwürfe zum „Jüngsten Gericht“ zu kontrollieren: „Diese eine Statue genügte, um Papst Giulio ein würdiges Grabmal zu sein“ – und ohne Zweifel hatte er damit Recht. „Moses“ ist sitzend dargestellt, Kopf und Blick nach links gewendet, der rechte Fuß fest auf dem Boden aufgestellt, das linke Bein zurückgezogen, so dass der Fuß nur noch mit den Zehen den Boden berührt, alles gespannt wie zum Aufspringen. Der rechte Arm hält die Gesetzestafeln, die Hand berührt den mächtig in Flechten herabwallenden, wunderschönen Bart, der die Brust bedeckt, die linke Hand ist auf den Schoß gelegt. Gesicht und Blick scheinen mir eine Mischung aus Zorn und Enttäuschung sowie vor allem Verachtung auszudrücken. Die imposante Gestalt ist mit einem ärmellosen Gewand bekleidet, das die muskulösen Arme nackt lässt. Durch die Barbarenhosen, wohl einschlägigen Darstellungen auf römischen Monumenten nachempfunden, soll „Moses“ als nicht-antike Figur gekennzeichnet werden, über dem rechten Knie liegt zu weiterer Charakteristik und Erkenntniserleichterung das Tuch gebreitet, mit dem der Prophet sein leuchtendes Antlitz vor dem verschreckten Volk zu verhüllen pflegte, wenn er von seinen hohen Begegnungen mit der Gottheit in die Niederungen der Menschen zurückkehrte.
Den aufmerkenden, durch irgendetwas veranlasst, nach links gewendeten Kopf und den eindeutig wie zum Aufspringen aufgesetzten linken Fuß, hat man seit Jacob Burckhardt als Hinweise auf die von Michelangelo beabsichtige Wiedergabe eines bestimmten, bekannten Augenblicks der Moses-Geschichte interpretiert: „Moses scheint in dem Moment dargestellt, da er die Verehrung des goldenen Kalbes erblickt und aufspringen will. Es lebt in seiner Gestalt die Vorbereitung zu einer gewaltigen Bewegung, wie man sie von der physischen Macht, mit der er ausgestattet ist, nur mit Zittern erwarten mag“ (Jacob Burckhardt. Gesammelte Werke, Bd. X: Der Cicerone, 2. Bd., S. 73).
Gegen diese geläufige Deutung mag sich vielleicht einwenden lassen, dass die Aufstellung der Figur mit anfangs sechs, später zumindest drei weiteren sitzenden Figuren geplant war, von denen sich nicht gut vorstellen ließe, dass sie ebenfalls alle miteinander hätten aufspringen sollen. Ebenfalls will mir diese anspruchslose Ansicht schlecht zum Charakter eines Grabmals passen, wo auch Papst Julius selber in ruhig sitzender Haltung dargestellt werden sollte. Vielleicht darf daher eine sublimer ergänzende Absicht des Künstlers auf eine umfassendere Wesensdeutung eines der wenigen ganz Großen der Menschheit und geistigen Gründers und Führers seines Volkes und Patrons der monotheistischen Weltreligionen zu unterstellen versucht werden.
Einen glücklichen Vorschlag zu einer vertieften Deutung des Kunstwerks in dieser Richtung hat, meine ich, Sigmund Freud in seinem erstmals 1914 veröffentlichen Essay „Der Moses des Michelangelo“ gemacht. Freud war die merkwürdige Berührung des Bartes durch die rechte Hand und zumal den Zeigefinger aufgefallen, und er hat das in einen stimmigen Zusammenhang mit den nach seiner Beobachtung auf den Kopf gestellten Gesetzestafeln gebracht. Daraus ergab sich für ihn der Verlauf einer Szene, deren Abschluss dann Michelangelo sozusagen in einer Momentaufnahme festgehalten hätte: Moses wird durch den plötzlichen Anblick des goldenen Kalbs oder den Lärm, den das Volk bei seinem Tanz um es herum machte, aus seiner sinnenden Gottesruhe aufgeschreckt, wendet den Kopf und sieht und versteht augenblicks den gotteslästerlichen Gräuel. In aufsteigender Erregung greift er sich heftig in den Bart, in Ermangelung eines anderen Objekts als dem eigenen Leib, um seine Wut daran auszulassen. Dadurch drohen ihm aber die an die Brust gepressten Tafeln zu entgleiten, und um ihr Zerschellen am Boden zu verhindern, fährt die rechte Hand zurück und stützt die Tafeln von neuem ab. Freud schreibt: „Unser Moses wird nicht aufspringen und die Tafeln nicht von sich schleudern. Was wir an ihm sehen, ist nicht die Einleitung zu einer gewaltsamen Aktion, sondern der Rest einer abgelaufenen Bewegung. Er wollte es in einem Anfall von Zorn, aufspringen, Rache nehmen, an die Tafeln vergessen, aber er hat die Versuchung überwunden, er wird jetzt so sitzen bleiben in gebändigter Wut, in mit Verachtung gemischtem Schmerz. Er wird die Tafeln nicht wegwerfen, daß sie am Stein zerschellen, denn gerade ihretwegen hat er seinen Zorn bezwungen, zu ihrer Rettung seine Leidenschaft beherrscht. Als er sich seiner leidenschaftlichen Empörung überließ, mußte er die Tafeln vernachlässigen, die Hand, die sie trug, von ihnen abziehen. Da begannen sie herabzugleiten, gerieten in Gefahr zu zerbrechen. Das mahnte ihn. Er gedachte seiner Mission und verzichtete für sie auf die Befriedigung seines Affekts. Seine Hand fuhr zurück und rettete die sinkenden Tafeln, noch ehe sie fallen konnten. In dieser Stellung blieb er verharrend, und so hat ihn Michelangelo als Wächter des Grabmals dargestellt“ (Studienausgabe, Bd. X: Bildende Kunst und Literatur, S. 214).
Voila! Solchermaßen hätte Michelangelo seinen „Moses“ in Tat und Wahrheit als Heros der Moralität, der sittlichen Selbstüberwindung verherrlicht haben können. „Damit hat er etwas Neues, Übermenschliches in die Figur des Moses gelegt, und die gewaltige Körpermasse und kraftstrotzende Muskulatur der Gestalt wird nur zum leiblichen Ausdrucksmittel für die höchste psychische Leistung, die einem Menschen möglich ist, für das Niederringen der eigenen Leidenschaft zugunsten und im Auftrage einer Bestimmung, der man sich geweiht hat“ (S. 217). Allein eine Deutung dieser Art, die, wohlgemerkt, auskommt, ohne jedweden Gebrauch von psychoanalytischen Ideen zu machen, vermöchte, meine ich, etwas von der Faszination zu erklären, die von Michelangelos „Moses“ noch heute auf den Betrachter ausgehen kann. Hiermit waren wirklich, wie Vasari Michelangelo gerühmt hat, die Alten übertroffen worden: Sublimste Regungen der Seele hätten ihren unübertroffenen Ausdruck gefunden, die gottgleiche Geistigkeit des Menschen noch über das stärkste Fleisch triumphiert, ja über schier übermenschliche Schönheit und Mächtigkeit des Fleisches hinaus wäre seine vollkommene Vergeistigung gelungen. Der „Moses“ mag daher als Idealbild des Papstes Julius geschaffen worden sein, so wie ihn sich Michelangelo gewünscht hätte, so wie er sich den Menschen überhaupt wünschte und so wie er sich wohl selbst erträumt hat: Verlebendigung eines Hochbildes gottgleichen Menschentums und Aufforderung an jedermann, Größtes zu wollen und zu vollbringen. Zu seiner Identifizierung mit Moses und zur Idealisierung des eigenen Wesens durch dieses Kunstwerk könnte Michelangelo aufgrund des gemeinsam jähzornigen, von heftigen Leidenschaften getriebenen Charakters gekommen sein: Von Moses war aus der Bibel bekannt, dass er in aufwallendem Zorn über die Misshandlung eines Stammesgenossen den Übeltäter, einen Ägypter, meuchlings erschlagen und in Wut und Enttäuschung über die Götzen anbetende Abtrünnigkeit seines Volkes die göttlichen Gesetzestafeln zerschmettert hatte. Von Michelangelo sind zahlreiche Fälle unbeherrschten Jähzorns überliefert. Und auch Julius II. war ein solch unbeherrschter, rücksichtsloser Mann gewesen, der gleichwohl Größtes gewollt hatte, nämlich die überfällige Einigung Italiens, natürlich unter der Herrschaft der Kirche, unter seiner Herrschaft. War Julius die Vollbringung dieser Idee, die noch Jahrhunderte bis zu ihrer Verwirklichung, wenn dann auch in säkularem Staat, brauchte, auch misslungen, so hätte ihm Michelangelo gemäß dieser Deutung mit seinem „Moses“ gleichwohl ein würdiges Denkmal der Wünschbarkeit dieses Gelingens gesetzt. Trotz des ihn übermächtig zu überwältigen drohenden Affekts hätte sein Moses-Papst die Beherrschung nicht verloren, seine hohe Bestimmung in diesem wütenden Aufstand des Fleisches nicht verraten, ihr geistig die Treue gehalten, d.h. die göttlichen Gesetzestafeln nicht zerschmettert, sondern sie als ein kostbarstes Gut der Menschheit vor der Vernichtung bewahrt. Und Michelangelo hat sich wahrlich berechtigt fühlen dürfen, mit der Mosesgestalt sich selbst ideal zu überhöhen, weil es ihm gelungen war, das Große nicht nur zu wollen, sondern mit eben dieser vollkommenen „Moses-Statue“ im Kunstwerk zu bewältigen. Als Künstler, darf man wohl sagen, hat Michelangelo in der Tat Vollendung erreicht, sein Leben ist ihm durch sein Werk, seine Besessenheit zu schaffen, geradezu aufgezehrt worden, ein heiliger Opfertod im Dienst der Kunst. Als empirischer Charakter war er – weiß Gott! – genauso problematisch wie irgendein anderer Großer und wie die allermeisten von diesen eine unverkennbar pathologische Natur. Die Titanen an Kraft und Geist, die er in der „Sixtinischen Kapelle“ und nach meinem Urteil am vollkommensten in dieser „terribilità-Gestalt“ des „Moses“ geschaffen hat, der einen die eigene Unzulänglichkeit so schmerzlich, aber doch auch mit der quälenden Forderung verbunden erfahren lässt, sich um die eigene Vervollkommnung zu bemühen, das notorisch Übermäßig-Übermenschliche all seiner Männer- wie Frauengestalten – man erinnere sich beispielsweise der titanischen Propheten und Sybillen in der „Sixtinischen Kapelle“ –, dürfte psychologisch als Überkompensation seines kleinen, gedrungenen Wuchses und einer Hässlichkeit zu verstehen sein, unter der er Zeit seines Lebens gelitten hat, zumal nachdem ihm in seiner Jugend ein neidischer Kumpan nach einem Streit das Nasenbein zerschmettert hatte. Von Lange-Eichbaum ist seine Pathographie folgendermaßen zusammengefasst worden: „Reizbar, Wutanfälle. Äußerste Empfindlichkeit, Wankelmut in der Zuneigung, plötzliche Sympathien, hochaufloderner Enthusiasmus, tiefe Beängstigungen, Misstrauen, viele Unbegreiflichkeiten und Inkonsequenzen. Kälte gegen das Weib. Hauptwerke: Männer“ (Genie, Irrsinn und Ruhm, S. 468).
Über einzelne Bewertungen dieser Art mag man streiten können, daran, dass Michelangelo, allgemein geurteilt, ein „stark schizoider Bionegativer mit paranoiden Zügen bei homosexueller Anlage“ gewesen ist (ebd.), ein meistenteils unausstehlicher Zeitgenosse, lässt sich kaum zweifeln. Depressiv veranlagt – klagesüchtig in eingebildetem Elend und dem vermeintlichen Unrecht, das ihm allerwärts angetan wurde; geizig ein großes Vermögen anhäufend, aber in menschenscheuer Verwahrlosung hausend – hat er sich enthusiastisch in seine Arbeit gestürzt und in asketischer Einsamkeit vergraben. Gleichwohl hat er trotz solch weitgehender, aber für den großen Menschen wohl unvermeidlicher Entfremdung von Welt und Mitmensch, Bilder beglückender Schönheit und begeisternder geistiger Souveränität des gottgleichen Menschen geschaffen. In die „Moses-Gestalt“ mag reichlich auch von der Menschenverachtung dieses Sonderlings mit eingeflossen sein, die ich für den physiognomisch beherrschenden Zug der Skulptur halte, besonders an den wie von Ekel und Abscheu vor aller Niederträchtigkeit der Menschen aufgeworfenen Lippen abzusehen. Dem mythisch erhöhten Moses der Bibel, der mit Gott höchstselbst alltäglichen Umgang pflegte, könnte dazu alles Recht zugebilligt werden, zumindest in Sichtweise dieser Deutung als Hochbild menschlicher Selbstüberwindung und hochsinniger Verachtung alles Menschlich-Allzumenschlichen, doch sollte dabei nie vergessen werden, dass solche Vergottungsbilder des Menschen kompensatorischem Wunschdenken entspringen.
Womöglich ist Michelangelo der frühe und danach sein langes Leben andauernde, übermäßige Ruhm, der von ihm nur noch als „il divino“ sprechen ließ, doch etwas zu Kopfe gestiegen. Hinzu kam die ganz außergewöhnlich hohe Einschätzung der Kunst in jener Zeit, die allen Ernstes dem göttlichen Schaffen gleichgesetzt wurde bzw. dieses sogar übertreffen sollte – nach Abschaffung des göttlichen Konkurrenten und der großen Kunst wird derselbe Traum wohl heute von den Technologen geträumt. Der Künstler, der Bildhauer der Renaissance, hat man sich damals einzureden versucht: Arbeitete er nicht in einem unvergleichlich dauerhafteren Material, dem Stein oder wenigstens mit Generationen überdauernden Farben, als Gott, dessen Geschöpfe aus schwachem Fleisch unvermeidlich während eines einzigen Menschenlebens dahinschwanden und vergingen? Und vermochte er nicht in seinen Statuen und Bildern dem Menschen eine Schönheit und Hoheit zu verleihen, im Vergleich wozu alles Natürlich-Gottgeschaffene nur als klägliches Abbild, ja Zerrbild erscheinen konnte? Und also mag sich auch ein Michelangelo zu Zeiten in den Wahn verstiegen haben, aus dem er allerdings im Alter schmerzlich und unter großen Ängsten über seine sündhafte frühere Überheblichkeit erwacht ist, in seinen allerwärts hochgerühmten Werken den göttlichen Schöpfer übertroffen, für die Ewigkeit geschaffen zu haben, in unüberbietbarer, idealer Seinsvollkommenheit, wogegen das dem göttlichen Schöpfer allein in vergänglichem, unvollkommenem, makelhaftem Fleisch gelungen sei. Aus diesem schönen Wunschtraum eines höchster Ehre werten Menschentums, wie ihn die Hoch-Renaissance und am ambioniertesten wohl Michelangelo geträumt hat, ist der große Shakespeare berufen gewesen, die Menschheit – und das hoffentlich ein für alle Mal – herauszureißen, der zwar auch die mögliche Größe des Menschen, für sie werbend, gefeiert hat, ihn aber nicht mehr als gottgleiches, sondern realistischer als endlich tragisches, schwindlig hinfälliges Wesen anzusehen gelehrt hat, dessen „Ewigkeiten“ allemal nur eine kleine Weile anhalten – so besonders im „Sturm“, dem Schwanengesang auch auf seine eigene, unübertroffen großartige Kunst:
„Das Fest ist jetzt zu Ende; unsre Spieler,
Wie ich auch sagte, waren Geister, und
Sind aufgelöst in Luft, in dünne Luft.
Wie dieses Scheines lockrer Bau, so werden
Die wolkenhohen Türme, die Paläste,
Die hehren Tempel, selbst der große Ball,
Ja, was daran nur Teil hat, untergehen;
Und, wie dies leere Schaugepräg erblaßt,
Spurlos verschwinden. Wir sind solcher Zeug
Wie der zu Träumen, und dies kleine Leben
umfaßt ein Schlaf“
(William Shakespeare: Ausgewählte Werke, 3. Bd., S. 557 f.).
Der andere Heros der Hoch-Renaissance ist natürlich Leonardo da Vinci gewesen. Ich werde nur über ein einziges Kunstwerk genauer befinden, und zwangsläufig ist das ein Gemälde. Noch ruhmreicher als mit der Skulptur, wo es im Grunde neben denen Michelangelos nur ganz wenige alles überragende Meisterwerke gab, hat die Renaissance-Kunst in der Malerei einen Gipfel schöpferischen Schaffens erzielt, und Leonardo war dessen allseits anerkannter Höchstpunkt. Mit seinem Werk ist die Idealtypik der Antike durch eine bedeutungsvollste Versinnbildlichung des verborgenen menschlichen Inneren in einem Maße überboten worden, wie sie einzig die Malerei in solcher Vollendung erreichen kann. Und am Beispiel Leonardos lässt sich, durchaus exemplarisch gemeint, womöglich überzeugend auch nachvollziehen, wie selbst ein allergrößtes Kunstwerk, das alle Bewunderung verdient und der Menschheit unverlierbar eine bis dato ungeahnte Möglichkeit ihres Wesens verklärend und berückend vor Augen gestellt hat, von der körperlich geistigen Konstitution des Künstlers und seinem Lebensschicksal bestimmt geblieben ist. Um von solcher Ansicht einen vielleicht nachhaltigen Eindruck zu vermitteln, werde ich mich in der Folge eng an die berühmte Deutung Leonardos von Sigmund Freud halten („Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci“), erstmals 1910 veröffentlicht: Ein geistsprühender und phantasievoller, zumindest bezaubernder Versuch, sich behutsam und verständnisvoll dem Geheimnis von Person und Werk Leonardos, zumal des berühmten Lächelns etlicher Figuren seiner Hauptwerke seit der Mona Lisa, anzunähern, um vielleicht ein wenig von der ungeheuren Wirkung zu verstehen, die der Maler bis heute ungebrochen ausübt – die „Mona Lisa“ des Louvre dürfte das berühmteste Gemälde aller Zeiten sein, und Freud ist der größte Psychologe zumindest des 20. Jahrhunderts gewesen, die ihm verdankte Psychoanalyse Leonardos darf als einmaliger Glücksfall gelten, wodurch Licht in eine Tiefendimension des Menschenwesens zu bringen versucht werden konnte, die andernfalls für immer im Dunklen bleiben müsste.
Den Ausgangspunkt für seinen Aneignungsversuch des wohl einzigartigen Universalgenies und dessen vielfach geheimnisvoller, rätselhafter Werke hat Freud aus Leonardos unbezweifelbar homosexueller Konstitution gewonnen – ob diese irgendwann manifest geworden ist, wird wohl für immer unentscheidbar bleiben. 1476, im Alter von ca. 24 Jahren, war Leonardo mit zwei weiteren Florentiner jungen Männern vor Gericht angeklagt worden, sexuelle Beziehungen zu einem homosexuellen Prostituierten gehabt zu haben, wurde aber aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Seine Schüler hat er später anscheinend weniger nach ihrem Talent als nach ihrem ansehnlichen Äußeren ausgesucht, es überwiegen darunter auffallend viele feminin oder vielleicht besser androgyn wirkende schöne Jünglinge, die ihm auch zu Modellen dienten. Der vorsichtige Freud wollte gleichwohl allein von ideeller, also sublimierter Homosexualität sprechen: „Ohne die Sicherheit seiner modernen Biographen zu teilen, die die Möglichkeit eines sexuellen Verkehrs zwischen ihm und seinen Schülern natürlich als eine grundlose Beschimpfung des großen Mannes verwerfen, mag man es für weitaus wahrscheinlicher halten, dass die zärtlichen Beziehungen Leonardos zu den jungen Leuten, die nach damaliger Schülerart sein Leben teilten, nicht in geschlechtlicher Betätigung ausliefen. Man wird ihm auch von sexueller Aktivität kein hohes Maß zumuten dürfen“ (S. 100; vgl. S. 107).
Ob also von Leonardo ausgelebt oder nicht, ganz gleich, fest steht, dass Homosexualität, entdeckt und nachgewiesen, noch in damaliger Zeit mit dem Scheiterhaufen bestraft wurde – man hatte daher Grund, seine vermeintlich abartige Anlage, so gut es ging, vor aller Welt zu verbergen. Zumindest ein Teil der Einsamkeit und totalen Entfremdung von seiner Mitwelt, aus der Leonardo sich Zeit seines Lebens nicht zu befreien vermochte, wäre so einigermaßen nachvollziehbar erklärt. Doch hatte diese extreme geistige Isolierung selbstverständlich auch noch andere Gründe, auf die noch einzugehen ist, ganz abgesehen davon, dass sie das verhängnisvolle Schicksal durchweg aller großen Künstler und Menschen ist, recht verstanden wohl die unerlässliche Bedingung ihres Kunstschaffens oder ihrer Außerordentlichkeit. An sich konnte Leonardo zu Lebzeiten ja als durchaus geselliger Mensch gelten, mit starkem Hang zu gefälliger Selbstdarstellung, reich und überreich gesegnet mit Talenten, die anderen Menschen zu Freude und Genuss seiner Vortrefflichkeit gereichen konnten. Herman Grimm hat in wenigen, treffenden Worten das herkömmliche Portrait eines über alle Maßen ausgezeichneten und liebenswerten Menschen geschildert: „Er selber, schön von Antlitz, stark wie ein Titan, freigebig, mit zahlreichen Dienern und Pferden und phantastischem Hausrat umgeben, ein perfekter Musiker, bezaubernd liebenswürdig gegen hoch und niedrig, Dichter, Bildhauer, Anatom, Architekt, Ingenieur, Mechaniker, ein Freund von Fürsten und Königen“ (S. 47) – welcher Kontrast zum griesgrämig-groben Michelangelo, mit dem er zwar die homosexuelle Konstitution teilte, aber an dessen argwöhnischem, ressentimentgeladenem, überall Beeinträchtigung fürchtendem Verfolgungswahn selbst Leonardos und später Raffaels Liebenswürdigkeit gescheitert ist! Und dennoch ist dieser von der Natur so überreich beschenkte Ausnahmemensch, das Universalgenie ohnegleichen, sein Lebtag ein Fremdling unter den Menschen geblieben, gehemmt im Leben wie im Schaffen. Von den unbedarften Zeitgenossen im Innersten abgesondert, ein unheimlich befremdend wirkender, völlig unzeitgemäßer Vegetarier und Pazifist, hat der Linkshänder seine genialen Ideen und Entdeckungen in schwer entzifferbarer Spiegelschrift zahllosen Notizbüchern anvertraut, die zu seinen Lebzeiten unveröffentlicht geblieben sind, im übrigen aber kaum etwas enthalten, was sein Innenleben wirklich aufschließen würde. Nur gelegentlich lässt sich etwas von seiner abgründigen Entfremdung ahnen, wenn beispielsweise die zynische Verachtung des Durchschnittsmenschen aus ihm herausbricht: „Wahrlich, manche sollten sich nur als Durchgang für die Nahrung, als Vermehrer des Unrats und als Füller von Jauchegruben bezeichnen, weil ihnen sonst nichts in der Welt offenbar wird, weil nichts Gutes durch sie vollbracht wird, weil von ihnen nichts übrig bleibt, als volle Jauchegruben“ (zit. Kurt E. Eisler: Leonardo da Vinci, S. 259). Oder: „Mir scheint, die rohen Menschen mit schlechtem Lebenswandel und geringem Denkvermögen verdienen ein so herrliches Werkzeug oder eine solche Fülle von Vorrichtungen eigentlich nicht wie die besinnlichen Menschen mit großem Denkvermögen, sondern nur einen Sack, in dem die Nahrung aufgenommen wird und aus dem sie entschwindet. Wahrlich, sie sind nur als ein Durchgang für die Nahrung zu betrachten; denn mich dünkt, sie haben nichts mit dem Menschengeschlecht gemein, außer der Stimme und der Gestalt, und stehen in allem übrigen tief unter dem Tiere“ (zit. S. 260) – doch wer außer ihm selbst dürfte sich zu Recht zu den „besinnlichen Menschen mit großem Denkvermögen“ rechnen?
Die Objektivität, die nackte Wahrheit solch verheerender Urteile ist an sich genauso evident, den Maßstab des Genies sondergleichen angelegt, wie sie wohl von kaum jemand ausgerechnet auf sich selbst bezogen worden ist. Gleicherweise verraten zahllose andere von Leonardo aufgezeichnete Beobachtungen und Urteile eine unerhörte Distanziertheit, eine Kühle bis ins tiefste Herz, eine einzigartige Objektivität und Klarsicht, der nicht das geringste Detail entgeht und die es sich hat angelegen sein lassen, von nie zu befriedigender Neugier angestachelt, sich alle Erscheinungen der Wirklichkeit mit ungemeiner Schaulust anzueignen. Mit der gleichen unersättlichen Wissbegierde hat er den Vogelflug erforscht und sezierte er Leichen; malte er seine engelgleichen Frauen- und Jünglingsgesichter und hielt die verzerrten Züge von Galeerensträflingen und Gehängten fest; konstruierte überaus nutzvolle oder Tod und Verderben bringende Maschinen; lebte seinen Forschungen hingegeben im trauten, kleinen Kreise seiner Schüler und verkehrte mit Fürsten, Königen und Päpsten; begleitete er, der erklärte Pazifist, Cesare Borgia auf seinen Raubzügen durch Mittelitalien und diente anstandslos jahrelang und zu dessen voller Zufriedenheit dem tyrannischen Herrscher Mailands, Ludovico Sforza, genannt „il moro“. Bereits den Zeitgenossen erschien er in seiner Widersprüchlichkeit als unlösbares Rätsel, blieb es bis zum heutigen Tage, und wird es wohl in alle Zukunft bleiben. Gleichwohl hat meiner Überzeugung nach Freud wie kaum ein anderer sein Teil dazu beigetragen, dass vom Lebensschicksal des großen Mannes her vielleicht ein Weniges von seinem hintergründigen Wesen erahnbar geworden ist und sich dadurch ebenfalls die unvergleichliche Faszination besser verstehen lässt, die bis heute von seinen wenigen Bildern ausgeht.
Anknüpfungspunkt der Freudschen Deutung von Leonardos Lebensgeschichte war seine Annahme von der ausschlaggebenden Bedeutung frühkindlicher Erlebnisse für das spätere Daseinslos eines Menschen, insbesondere des Sexualtriebes – nur leider Gottes ist über die Kindheit Leonardos wenig Gesichertes bekannt. Es existieren einzig zwei schriftliche Dokumente, die aber verhältnismäßig nichtssagend sind und im Übrigen, je nach Standpunkt, verschieden interpretiert werden können. Im ersten, das erst jüngst aufgefunden wurde, sind von Leonardos Großvater väterlicherseits in einer Art Familienregister Leonardos genaue Geburts- und Taufdaten festgehalten worden, obwohl das Kind ja nicht der legitimen Ehe seines Sohnes entstammte, sondern dessen vorheriger Beziehung zu einer jungen Frau namens Caterina, wahrscheinlich einem Bauernmädchen, mithin geringeren Standes als der Vater Leonardos, Ser Piero da Vinci, der einer alteingesessenen Notarsfamilie angehörte. Ein gewichtiger Umstand bei der Freudschen Rekonstruktion von Leonardos früher Kindheit war seine Annahme, das Kind habe die ersten drei bis fünf Jahre bei seiner von seinem Vater verlassenen Mutter verbracht. Der anscheinend ehrgeizige Ser Piero hatte nämlich noch im Geburtsjahr Leonardos eine junge Florentinerin aus reichem Hause geheiratet und lebte seither seiner Karriere in Florenz. Beim zweiten schriftlichen Dokument handelt es sich um eine Steuererklärung von Leonardos Großvater aus dem Jahre 1457, worin das Kind als abzugsfähiges Familienmitglied im Haushalt des Großvaters reklamiert wird. Kurt Eisler, dem ich die Informationen über diese verzwickten Details verdanke, hat auf den fragwürdigen Wahrheitsgehalt solcher Steuererklärungen aufmerksam gemacht, wo wohl zu allen Zeiten die Wahrheit unversehens ein wenig zu eigenen Gunsten korrigiert worden ist. Dennoch gibt es keinen Grund daran zu zweifeln, dass das Kind spätestens mit fünf Jahren zum Haushalt seines Großvaters gehört hat. Die Mutter Leonardos ist zu dieser Zeit mit einem Kalkbrenner verheiratet gewesen, wie der Großvater es ebenfalls vermerkt hat. Aber war das Kind auch vorher schon, entweder allein oder zusammen mit seiner Mutter, in die Familie seines Großvaters aufgenommen worden, oder hatte es zumindest einige Zeit lang, drei oder fünf Jahre, wie Freud annimmt, entweder allein mit der verlassenen Mutter oder zumindest im Hause des Stiefvaters mit ihr zusammengelebt? Diese Fragen verlässlich zu beantworten, erscheint derzeit unmöglich, alles bleibt hier Mutmaßung. Was Freud aber für seine weiteren Schlussfolgerungen als einzig belangreich im Falle Leonardos angesetzt hat, nämlich eine übergroße Mutterbindung bei Entbehrung des Vaters, will mir bei den gegebenen Umständen mehr als wahrscheinlich vorkommen, zumal dazu bereits einige Monate bis längstens ein Jahr während der präödipalen Phase genügt haben würden. Und dass eine schmählich sitzen gelassene, blutjunge Mutter, ob sie nun eine Zeitlang allein mit ihrem Kind gelebt hat oder mit ihm zusammen im Haushalt des Vaters ihres treulosen Liebhabers oder in einer wahrscheinlich arrangierten Ehe mit einem vermutlich ungeliebten, jedenfalls armen Handwerker, ganz gleich, ihre ungeteilte, unversehens übermäßige Liebe ihrem Sohn zugewendet hat, erscheint mir mehr als plausibel – die einzigartige Begabung des Kindes selbst in diesen jungen Jahren kann doch kaum gänzlich verborgen geblieben sein, zumal nicht für den Stolz einer jungen Mutter und eines anscheinend treu für es sorgenden Großvaters, und die außergewöhnliche, liebenswürdige Schönheit Leonardos, also wohl auch schon in seiner Kindheit, hat zum festen Bestandteil seiner Rühmung gehört. Dass infolgedessen das so oder so vaterlose Kind, ein Bastard, seinen leiblichen Vater, den es gleichwohl im Dorf oder sogar im Hause seines Großvaters treffen und sehen konnte, nicht schmerzlich hätte entbehrt haben sollen, ist wohl ebenfalls kaum anzunehmen. Freuds Ansichten hinsichtlich der frühen Kindheit Leonardos erscheinen mir daher wohl fundiert, obwohl die genaueren Umstände von Leonardos Kindheit nicht hinlänglich bekannt sind und andere Rekonstruktionen daher nicht ausgeschlossen werden können. Im Übrigen hat Freud seine psychoanalytischen Schlussfolgerungen aber gar nicht hauptsächlich auf die ungeklärten frühen Lebensumstände Leonardos gestützt, sondern diese im stimmigen Zusammenhang mit einer außergewöhnlichen, sehr merkwürdigen Kindheitserinnerung Leonardos gesehen, der einzig bekannten überhaupt. Leonardo hatte sie anlässlich seiner Studien zum Vogelflug wie nebensächlich notiert. Doch gerade solch spontane, arglos hinterlassene Äußerungen von scheinbarer Belanglosigkeit eröffnen dem Psychoanalytiker bekanntlich den Königsweg zum Unbewussten und zum ihr selbst verborgenen Inneren einer Person – es lässt sich gut nachfühlen, dass Freud beim Nachdenken über diese von allen anderen Autoren missachtete Nebenbemerkung, zu deren Aufschließung er das gesamte stattliche Arsenal seines sublimen psychologischen Instrumentariums ins Spiel bringen und es zumindest in den eigenen Augen glänzend bewähren konnte, die gehörige Begeisterung über eine große Entdeckung verspürt haben muss, so dass er später in eingewöhntem Understatement die kleine Studie die „einzige hübsche Sache“ genannt haben soll, die ihm je geglückt sei.
Nun war Freud allerdings bei der Wiedergabe der Übersetzung besagter Erinnerung Leonardos aus seinen Quellen ein fataler Irrtum unterlaufen, der das gesamte Unterfangen außerordentlich in Misskredit gebracht hat. Ich gebe zunächst Freuds Fassung der Einlassung Leonardos das Wort: „Es scheint, dass es mir schon vorher bestimmt war, mich so gründlich mit dem Geier zu befassen, denn es kommt mir als eine ganz frühe Erinnerung in den Sinn, als ich noch in der Wiege lag, ist ein Geier zu mir herabgekommen, hat mir den Mund mit seinem Schwanz geöffnet und viele Male mit diesem seinen Schwanz gegen meine Lippen gestoßen“ (S. 109). Unverzüglich wird man eine angebliche derartige Erinnerung eines Kindes in der Wiege für außerordentlich unglaubwürdig halten, und es hat eines Freud bedurft, um diesem sinnlos erscheinenden Kauderwelsch wie einem unverständlichen Traum einen plausiblen Sinn abzugewinnen. Wie ihm das gelungen ist, halte ich für schlechthin bewundernswert und dürfte im Kontext der Grundannahmen Freuds vorzüglich ausgewiesen sein. Gleichwohl bleibt alles selbstverständlich fragwürdige Spekulation, dessen ist sich der ebenso vorsichtige wie gewissenhafte Freud selber auch durchaus bewusst gewesen: Es handelt sich bei dieser Schrift um eine Art psychologischen Romans, wenn man so will. Doch wie im Falle von Shakespeares „Hamlet“, dessen Deutung durch Freuds Miteinbeziehung der „Ödipus-Problematik“ eine bis dato ungeahnte Tiefendimension hinzugewonnen wurde, so dass erst dadurch etwas von der einmalig faszinierenden Wirkung des Stücks begreiflicher geworden sein könnte, gestattet ebenfalls erst eine solche psychoanalytische Interpretation die befremdliche Äußerung Leonardos mit wohlbekannten Tatsachen aus seinem Erwachsenen- und Künstlerleben in Übereinstimmung zu bringen und dieses dadurch einem tieferen Verständnis aufzuschließen – beispielsweise die homosexuelle Konstitution; die rätselhafte Hemmung, angefangene Kunstwerke zu vollenden, so dass es nur eine geringe Anzahl von Gemälden gibt, die einwandfrei allein von seiner Hand stammen; oder das schließliche Versiegen jedweden Antriebs zu künstlerischer Gestaltung zugunsten eines überbordenden Forschungstriebes. Und darüber hinaus könnten dadurch womöglich auch die bis heute anhaltende Wirkung und der eminente Bekanntheitsgrad von berühmtesten Gemälden Leonardos, wie des Mailänder „Abendmahls“ und besonders der „Mona Lisa“, etwas verständlicher werden. Daher ist es Freud gar nicht genug zu danken, dass er solchen scheinbar entlegenen und bedeutungslosen Belanglosigkeiten seine volle Aufmerksamkeit geschenkt hat und auf diese Weise eine zusätzliche, nicht so leicht durch eine andere Methode zu ersetzende Chance entdeckt hat, etwas über diese frühkindlichen, mit Sicherheit das Leben zutiefst mitprägenden Erlebnisse in Erfahrung bringen zu können, um die doch das Schicksal bestimmende sexuelle Konstitution in ihrer immensen Bedeutsamkeit für das Lebensschicksal aller Menschen, auch der genialsten, besser würdigen zu lernen. Wie dürftig und wahrheitslos fallen im Vergleich die allermeisten Biographien berühmtester Männer und Frauen aus! Was erfährt man dort über ihre Mütter und Väter, das Verhältnis zu den Geschwistern, ihre sexuellen Gewohnheiten, ihr Sterben? – vorbehaltlos sehr viel weniger als zu einem überzeugenden Verständnis der wirklich Großen erforderlich wäre. Und durch Bekanntschaft mit ihrem Menschlich-Allzumenschlichen müssten sie nach meiner Überzeugung von ihrer wirklich bedeutsamen Größe keineswegs einbüßen, vielmehr wäre jedweder nur wünschbaren Identifizierung mit ihnen und zumal mit ihren Werken der günstigere Boden bereitet.
Für Freud hat selbstredend, was Leonardo in dieser Nebenbemerkung notiert hatte, keinesfalls als unverfälschte Erinnerung an ein tatsächliches Ereignis in dessen Säuglingszeit zu gelten, sondern als eine der Deutung harrende Phantasie über tatsächlich Geschehenes und Erlebtes, die sich später gebildet hat, das wirkliche Geschehnis der Person selber verdeckte, aber es dem kundigen Psychoanalytiker zu erraten erlaubt: „Es ist nicht gleichgültig, was ein Mensch aus seiner Kindheit zu erinnern glaubt; in der Regel sind hinter den von ihm selbst nicht verstandenen Erinnerungsresten unschätzbare Zeugnisse für die bedeutsamsten Züge seiner seelischen Entwicklung verborgen. Da wir nun in den psychoanalytischen Techniken vortreffliche Hilfsmittel besitzen, um das Verborgene ans Licht zu ziehen, wird uns der Versuch gestattet sein, die Lücke in Leonardos Lebensgeschichte durch die Analyse seiner Kindheitsphantasie auszufüllen. Erreichen wir dabei keinen befriedigenden Grad von Sicherheit, so müssen wir uns damit trösten, daß so vielen anderen Untersuchungen über den großen und rätselhaften Mann kein besseres Schicksal beschieden war“ (S. 111 f.).
Die erste orthodox psychoanalytische Aufklärung Freuds besagt nun, dass die befremdlichste und unglaubwürdigste Einzelheit der Phantasiegeschichte – der Vogel, der mit seinem Schwanz gegen die Lippen des Kindes stößt – als Deckerinnerung für ein ganz alltägliches Ereignis der frühen Kindheit zu verstehen sei: das Gesäugtwerden von der Mutterbrust, mithin der Vogelschwanz als Phantasieersatz für die Mutterbrust zu gelten habe (vgl. S. 113). Wieso das in Leonardos Erinnerung unverkennbar einer Fellatio, dem in den Mund eingeführten Penis, gleichkommt, muss im Zusammenhang mit der vermuteten Homosexualität Leonardos zu erraten versucht werden. Zunächst hätte sich zwanglos auf diese Weise eine Bestätigung für Freuds Annahme ergeben, dass der Junge eine Zeit lang mit seiner Mutter zusammengelebt und von ihr gepflegt und auch gesäugt worden sei – schlechterdings nichts Außergewöhnliches. Aus den übrigen gesicherten bzw. verlässlich unterstellbaren Lebensumständen – die vom Liebhaber verlassene Mutter, als einziger Trost das vielversprechende Kind – hat Freud – für mich genauso überzeugend – eine übermäßige Mutterbindung Leonardos abgeleitet, verstärkt durch die Entbehrung des Vaters. Er hat sich also vorgestellt – psychologisch ganz einwandfrei, wenn auch bloße Mutmaßung –, die im Stich gelassene Mutter habe ihre zärtliche Liebe vollständig ihrem Sohn zugewendet und mit übermäßigen Küssen und Liebkosungen in ihm einen Ersatz für den untreuen Liebhaber gesucht. Das hätte zur vorzeitigen Erweckung von libidinösen Empfindungen des Kleinkindes geführt, die verhängnisvoll und unabänderlich auf die Mutter fixiert geblieben wären. Laut Freud hätte sich auf diese Weise die Grundveranlagung zumindest für einen bestimmten Typ von Homosexualität ergeben können: „Bei allen unseren homosexuellen Männern gab es in der ersten, vom Individuum später vergessenen Kindheit eine sehr intensive erotische Bindung an eine weibliche Person, in der Regel an die Mutter, hervorgerufen oder begünstigt durch die Überzärtlichkeit der Mutter selbst, ferner unterstützt durch ein Zurücktreten des Vaters im kindlichen Leben“ (S. 124).
„Der Knabe verdrängt die Liebe zur Mutter, indem er sich selbst an deren Stelle setzt, sich mit der Mutter identifiziert und seine eigene Person zum Vorbild nimmt, in dessen Ähnlichkeit er seine neuen Liebesobjekte auswählt. Er ist so homosexuell geworden; eigentlich ist er in den Autoerotismus zurückgeglitten, da die Knaben, die der Heranwachsende jetzt liebt, doch nur Ersatzpersonen und Erneuerungen seiner eigentlichen kindlichen Person sind, die er so liebt, wie die Mutter ihn als Kind geliebt hat“ (S. 125).
„Anderes als Spuren von unverwandelter sexueller Neigung werden wir bei Leonardo nicht erwarten dürfen. Diese weisen aber nach einer Richtung und gestatten, ihn noch den Homosexuellen zuzurechnen. Es wurde von jeher hervorgehoben, daß er nur auffällig schöne Knaben und Jünglinge zu seinen Schülern nahm. Er war gütig und nachsichtig gegen sie, besorgte und pflegte sie selbst, wenn sie krank waren, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt, wie seine eigene Mutter ihn betreut haben mochte. Da er sie nach ihrer Schönheit und nicht nach ihrem Talent ausgewählt hatte, wurde keiner von ihnen, Cesare da Sesto, G. Boltraffio, Andrea Solaino, Francesco Melzi und andere, ein bedeutender Maler“ (S. 127).
Ich vermag mich des Eindrucks nicht zu erwehren, dass vom rätselhaften Wesen Leonardos hier wirklich etwas geahnt worden ist. Nicht einmal ein langjähriges, enges Zusammenleben allein mit der Mutter anzunehmen, wäre nötig, als Unterstellung genügte ihre Überzärtlichkeit, die gut begründet erscheint. Freud ist nun allerdings durch eine Nachlässigkeit dazu verführt worden, das Bisherige, das außerordentlich plausibel erscheint, durch eine, wie sich später herausstellte, abwegige mythologische Spekulation noch zusätzlich abstützen zu wollen. Das hat schlimme Folgen für die Glaubwürdigkeit der gesamten Studie gehabt. Ungeprüft hatte er nämlich als Übersetzung des italienischen „nibio“, was „Milan“ bedeutet, aus seiner Vorlage „Geier“ übernommen und sich dadurch zu einem Ausflug in die ägyptische Mythologie bewogen gefühlt. Dort war dem Geier symbolisch alleinige Mutterbedeutung zugesprochen worden, weil phantasiert wurde: Es gibt überhaupt nur weibliche Geier, und die empfangen durch den Wind, mithin ohne Mitwirkung von Geiermännchen. Zudem wurde die geierköpfige Göttin Mut in den meisten Darstellungen mit Phallos abgebildet. Dass all das so erregend zu den bislang berichteten Grundannahmen Freuds passte, mag seine Nachlässigkeit in diesem Punkte erklären, gewiss nicht entschuldigen. Die mythologischen Einzelheiten brauchen uns jedoch nicht zu interessieren, da sie durch den Übersetzungsfehler allesamt irrelevant geworden sind. Wäre aber damit die gesamte Rekonstruktion und Sinndeutung der Kindheit Leonardos durch Freud endgültig ad acta zu legen? – das glaube ich nicht. Die Fakten der unehelichen Geburt und Trennung vom Vater, als deren naheliegende Folge die Fixierung auf die Mutter durch erfahrene Überzärtlichkeit und eine daraus ableitbare latente Homosexualität, scheinen mir in einen überzeugenden gedanklichen Zusammenhang gebracht zu sein. Und die immerhin allgemein zu Recht in Ansatz zu bringende Vogelbedeutung des Milans wie die spätere Ersetzung der Mutterbrust durch den Penis unter Betonung heftigen, aggressiven Eindringens in den Mund, ließe, wie Eisler angemerkt hat, auf ein ambivalentes Verhältnis bereits des Kleinkinds, umso mehr des Heranwachsenden zur leiblichen Mutter schließen (vgl. S. 24 f., 31): Eine Zeit lang hatte sie ihn vergöttert, ihn aber dann, als er in den Haushalt des Großvaters verbracht wurde, nach Gefühl des Kindes im Stich gelassen, ihn im Übrigen als Bastard in die Welt gesetzt und so für sein ganzes Leben stigmatisiert.
Diese verblüffende gedankliche Synthese, in die Freud die bekannten Umstände der frühen Kindheit Leonardos mit seiner Deutung der Erinnerungsphantasie in eine stimmige Einheit gebracht zu haben glauben konnte, erlaubte ihm nunmehr, zwei weitere wesentliche Eigenheiten aus dem Erwachsenenleben Leonardos in schlüssigem Zusammenhang damit zu sehen, die bereits den Zeitgenossen aufgefallen waren. Die erste stellte nur sozusagen die Kehrseite der zwar bloß erschlossenen, aber doch außerordentlich wahrscheinlich gemachten Homosexualität dar und vermag deren Annahme ihrerseits noch zu unterstützen. Schon 1898 hatte Freud in einem Brief an Wilhelm Fließ über Leonardo notiert, von diesem sei „kein Liebeshandel bekannt“ geworden (zit. in der editorischen Vorbemerkung zu Freuds Essay, S. 88). In der Studie hat er dazu weiter ausgeführt: „Es ist zweifelhaft, ob Leonardo jemals ein Weib in Liebe umarmt hat; auch von einer intimen seelischen Beziehung zu einer Frau ... ist nichts bekannt“ (S. 98). Daher reklamierte Freud – und alles, was aus Leonardos Leben publik geworden ist, scheint mir dafür zu sprechen, dass er hier ganz recht gesehen und geurteilt hat – Leonardo als ein „Beispiel von kühler Sexualablehnung“ (S. 97) und nahm eine „Verkümmerung seines Sexuallebens“ (S. 107) an: „Leonardo wird abstinent leben können und den Eindruck eines asexuellen Menschen machen“ (S. 154). Ja, Leonardo scheint von ausgesprochenem Ekel vor allem Sexuellen beherrscht gewesen zu sein. Freud hat in diesem Zusammenhang eine entlarvende Notiz von Leonardo zitiert: „Der Zeugungsakt und alles, was damit in Verbindung steht, ist so abscheulich, daß die Menschen bald aussterben würden, wäre es nicht eine althergebrachte Sitte und gäbe es nicht noch hübsche Gesichter und sinnliche Veranlagungen“ (S. 97).
Gemäß Freuds Lehre von der Allgegenwärtigkeit des Sexualtriebs ist dergleichen Asexualität zu leben aber nur möglich, wem gelungen ist, den allmächtigen Trieb umzuleiten, d.h. ihn im Falle Leonardos – neben der Verdrängung in eine ideelle Homosexualität – auf ungewöhnlich vollständige Weise zu sublimieren: Leonardos nicht ausgelebte Sexualität habe somit seine künstlerische Produktivität und zunehmend stärker seinen Forschungsdrang gespeist. Nachvollziehen ließe sich das, so Freud, nur, wenn aufgrund der zärtlichen Verführung durch die Mutter der sexuelle Trieb und die sexuelle Neugier des Kindes allzu früh geweckt worden wären, aber später, bei ihrer Unterdrückung und Verdrängung sowie zufolge einer unableitbaren, einmaligen konstitutionellen Begabung Leonardos zur Sublimierung, die gesamte angestaute Energie vornehmlich in Wissbegier verwandelt worden sei. „Daß es ihm (Leonardo, d. Verf.) nach infantiler Betätigung der Wißbegierde im Dienste sexueller Interessen dann gelungen ist, den größeren Anteil seiner Libido in Forscherdrang zu sublimieren, das wäre der Kern und das Geheimnis seines Wesens“ (S. 107).
Und anscheinend hat es in der Sphäre von Forschung und Wissenschaft, denen sich Leonardo im Verlauf seines Lebens exzessiv zugewendet hat, nichts von der sonderbaren Hemmung seiner Tat- und Schaffenskraft als Künstler gegeben – das wäre demnach die zweite oben angesagte Auffälligkeit gewesen. Im Falle der Malerei hätte sich diese Gehemmtheit evidenterweise als außerordentlich hinderlich erwiesen, so dass er vielleicht kein einziges seiner Werke wirklich vollendet hat, obwohl er oft jahrelang daran arbeitete; vieles alsbald nach Beginn wieder aufgab oder seine Schüler fertig malen ließ; anderes in selbsterfundenen, unzulänglichen Techniken ausführte, und es so zu rascher Zerstörung verurteilt hat. Freud merkte dazu an, Leonardo habe seine Werke, sozusagen seine Kinder, genauso leichtfertig, zufolge seiner Identifizierung mit dem Vater, aufgegeben, wie dieser ihn als Kind im Stich gelassen hatte (vgl. S. 144). Zugleich sei ihm so aber auch eine günstige Lösung des Ödipuskonflikts geglückt, in den er durch die Umstände seiner Kindheit zwangsläufig hineingezogen wurde: „Wer als Kind die Mutter begehrt, der kann es nicht vermeiden, sich an die Stelle des Vaters setzen zu wollen, sich in seiner Phantasie mit ihm zu identifizieren und später seine Überwindung zur Lebensaufgabe zu machen“ (S. 143) – Leonardo hätte somit erfolgreich die obligate Auflehnung gegen den Vater zustande gebracht, indem er sich lebenslänglich gegen alle Autoritäten verwahrte, und das sei die Grundbedingung seines einzigartig-autonomen Werdegangs als Forscher gewesen (vgl. S. 145). Denn hier habe sich ihm ein unabsehbares Reich eröffnet, wo er mit seinem unerreichten Tatsachensinn in verwegenen Eroberungen jedwede vorgegebene Autorität triumphierend hätte überwinden können, laut Freud selbstredend ebenfalls die Autorität von Religion und Kirche, obwohl man in damaligen Zeiten einer noch ungebrochenen Herrschaft des Klerus gut daran tat, dergleichen lieber nicht laut zu äußern und am besten noch vor sich selbst zu verschweigen: „In den Aufzeichnungen, welche Leonardo in die Ergründung der großen Naturrätsel vertieft zeigen, fehlt es nicht an Äußerungen der Bewunderung für den Schöpfer, den letzten Grund all dieser herrlichen Geheimnisse, aber nichts deutet darauf hin, dass er eine persönliche Beziehung zu dieser Gottesmacht festhalten wollte. Die Sätze, in welche er die tiefe Weisheit seiner letzten Lebensjahre gelegt hat, atmen die Resignation des Menschen, der sich der Anágke, den Gesetzen der Natur, unterwirft und von der Güte oder Gnade Gottes keine Milderung erwartet. Es ist kaum ein Zweifel, dass Leonardo die dogmatische wie die persönliche Religion überwunden und sich durch seine Forscherarbeit weit von der Weltanschauung der gläubigen Christen entfernt hatte“ (S. 147). Einen für ihn ganz ungewöhnlichen Ausbruch des Triumphs über jeglichen Autoritätsglauben hat sich Leonardo heimlicherweise erlaubt, als er Jahrzehnte vor der Veröffentlichung des Kopernikus und mehr als ein Jahrhundert vor dem Prozess gegen Galilei in seine Notizbücher mit Großbuchstaben eintrug: „IL SOLE NON SI MOVE“ (zit. Freud, S. 103).
Aus all dem, was Freud und Eisler in seiner Nachfolge mit zahllosen zusätzlichen Einzelheiten, die ich hier übergehen muss, hypothetisch zum psychologischen Charakter Leonardos vorgebracht haben, ließe sich aber auch ein glaubhafter Einblick in das Geheimnis der ungeheuren Wirkung der Gemälde Leonardos gewinnen. Wie vorangemeldet, beschränke ich mich zum Nachweis dieser Behauptung in der Hauptsache auf ein einziges Gemälde, die „Anna Selbdritt“ aus dem Louvre, wohl im Zeitraum von 1500-1513 von ihm gemalt, das genaue Datum ist nicht bekannt). (Abbildung_1 / Abbildung_2)
Besagtes Thema hat den Künstler anscheinend fasziniert, außer dem Bild im Louvre gibt es noch den „Burlington-House-Karton“ in der „National Gallery“, London, der 1498-1507 datiert wird, und zumindest weiß man noch von dem nicht erhaltenen sogenannten „Serviten-Karton“, wahrscheinlich aus dem Jahre 1501. Aller Wahrscheinlichkeit nach bezieht sich auf letzteren ein Bericht Vasaris, der deutlich macht, mit welcher Begeisterung die Werke Leonardos damals aufgenommen wurden und wie berühmt der Künstler zumindest in seiner Heimatstadt war. Vasari schreibt: „Endlich verfertigte er einen Karton, worauf die Madonna, die heilige Anna und das Christuskind so schön abgebildet waren, daß nicht nur alle Künstler, sondern jeder sich zur Bewunderung verpflichtet fühlte, der sie anschaute. Zwei Tage lang sah man Männer und Frauen, jung und alt wie in einem glänzenden Fest nach dem Zimmer wallfahrten, um das Wunderwerk Leonardos zu sehen“ (Künstler der Renaissance, S. 239 f.).
Auch das Bild im Louvre muss als unvollendet gelten (vgl. Kenneth Clark: Leonardo da Vinci, S. 141 f.). Zur Ikonographie gibt es glücklicherweise eine Angabe in einem zeitgenössischen Brief des Karmelitermönches Fra Pietro da Novellara aus dem Jahre 1501 an die Marquesa Isabella d‘Este, Herzogin von Mantua (vgl. Clark, S. 101). Die Dame hätte liebend gerne ein Bild von der Hand Leonardos gehabt und beauftragte den Mönch, den als schwierig geltenden Künstler, der kaum noch malte, für eine Bestellung zu gewinnen. Zwar beziehen sich die Bemerkungen und Beschreibungen des Mönches auf eine ebenfalls verloren gegangene Vorstudie, die aber, anders als der „Burlington-House-Karton“, im Wesentlichen mit dem Louvre-Bild übereinstimmte. Demnach sollte mit dem beigefügten Lamm die Passion Christi bedeutet werden. Da das Kind nach dem Lamm greife und sich anschicke, auf seinen Rücken zu steigen, solle dadurch die Annahme des Leidens- und Todesschicksals durch Jesus Christus versinnbildlicht worden sein. In unwillkürlicher mütterlicher Besorgtheit versuche Maria, ihr Kind vor diesem schrecklichen Los zu bewahren und es zurückzuhalten, vielleicht aber auch einfach nur davon abzuhalten, das unschuldige Tier weiter zu malträtieren, das durch den kleinen Jesus ja recht unsanft behandelt wird. Die hl. Anna in ihrer Weisheit dagegen wisse, dass der freiwillige Opfertod das Lebensschicksal des göttlichen Kindes sei und verharre daher in der Ruhe einsichtsvoller Gelassenheit.
Diese erste bekannt gewordene Deutung wird man zu respektieren haben. Bewundert worden ist wohl schon damals die virtuose Komposition der drei oder – mit dem Lamm zusammen – vier Figuren in Pyramidenform, die hernach zum Kanon zahlreicher Bilder der Hoch-Renaissance geworden ist. Leonardo hatte das vornehmlich dadurch erreicht, dass er Maria quer auf dem Schoß ihrer Mutter sitzend dargestellt hat und sie sich zu ihrem Söhnlein hinunterbeugen lässt, um nach ihm zu greifen. Formal wird durch Bannung der Figuren in das Pyramidendreieck eine unerhörte äußere Einheit der gesamten Gruppe erreicht, der inhaltlich-innerlich durch das vertrauensvolle Auf-dem-Schoß-ihrer-Mutter-Sitzen der Maria und ihre eigene liebevolle Besorgnis um ihren Sohn entsprochen ist – schon dieser harmonische Zusammenklang von äußerem Bildaufbau und innerem, seelischem Gehalt beweist die Höchstrangigkeit des Gemäldes, es muss unter die wenigen allergrößten Meisterwerke der Menschheit gerechnet werden.
Allerdings bedarf es zum Ausweis dieser Behauptung noch einiger zusätzlicher Überlegungen.
Vordringlich sind es zwei Umstände gewesen, die von jeher den besinnlichen Betrachter irritiert und zum Nachdenken aufgefordert haben. Einmal war das die auffällige Jugendlichkeit der heiligen Anna, die nur um ein weniges älter als ihre Tochter erscheint; und zum anderen das berühmte „Leonardeske“ Lächeln, das beiden Figuren, Mutter wie Tochter, zu eigen ist, mag es auch bei der Mutter Anna noch geheimnisvoller, unergründlicher, befremdlicher, aber auch bedeutender, faszinierender ausgefallen sein als im lieblicheren Falle der Tochter Maria. Dass Freud auf diese beunruhigenden, schwierigst zu lösenden Rätsel des Bildes, auf denen eklatant seine immense Wirkung beruht, eine klärende Antwort versucht hat, macht in meinen Augen den hohen Anspruch seiner Deutung aus und beweist die Fruchtbarkeit und Überlegenheit der psychoanalytischen Methode, die noch Antworten geben kann, wo oberflächlichere Erklärungsversuche die implizierte Tiefendimension der Fragen überhaupt nicht mehr wahrzunehmen vermögen. So gibt beispielsweise Jack Wassermann (Leonardo da Vinci, S. 118) eine theologische Erklärung für die stupende Jugendlichkeit der Anna, die man respektieren kann, ohne dass die Freudsche, sehr viel tiefer reichende Deutung dadurch tangiert oder gar widerlegt würde. Wassermann hat darauf hingewiesen, dass zum Ende des 15. Jahrhunderts die Fragestellung diskutiert wurde, ob die hl. Anna als Mutter der reinen Gottesmutter nicht ihrerseits bereits unbefleckt empfangen worden sein müsse – Leonardo habe daher mit ihrer Jugendlichkeit ihre spirituelle Reinheit dartun wollen. Nun darf aber, meine ich, Leonardo nicht mit Michelangelo verwechselt werden, der sich bezüglich seiner jugendlichen „Pietà-Maria“ aus dem Petersdom in ähnlichem Sinn geäußert haben soll, wie oben berichtet (vgl. S. 153). Leonardo dagegen war ein Ungläubiger und von ungemeiner Klarsicht für die Realität des Natürlich-Menschlichen, ihm solch widernatürliche Wunschvorstellung zuzuschreiben, fiele mir schwer. Allenfalls ließe sich bei ihm eine gewisse Bereitwilligkeit annehmen, sich den Wünschen seiner frommen Auftraggeber zu fügen. Doch im Übrigen bliebe dabei – was entscheidend ist – das durch die Jahrhunderte zahllose Menschen zauberhaft einnehmende Lächeln völlig unerklärt. Die Eleganz und Überzeugungskraft des Freudschen Lösungsversuchs besteht gerade darin, dass er einen einleuchtenden Zusammenhang der beiden außergewöhnlichen Merkwürdigkeiten herzustellen wusste.
Denn Freud hatte ja angenommen, wie schon gehört, Leonardo habe zwei jugendliche Mütter gehabt: „Leonardos Kindheit war gerade so merkwürdig gewesen wie dieses Bild. Er hatte zwei Mütter gehabt, die erste seine wahre Mutter, die Catarina, der er im Alter zwischen drei und fünf Jahren entrissen wurde, und eine junge und zärtliche Stiefmutter, die Frau seines Vaters, Donna Albiera. Indem er diese Tatsache seiner Kindheit mit der ersterwähnten, der Anwesenheit von Mutter und Großmutter, zusammenzog, sie zu einer Mischeinheit verdichtete, gestaltete sich ihm die Komposition der heiligen Anna selbdritt. Die mütterliche Gestalt weiter weg vom Knaben, die Großmutter heißt, entspricht nach ihrer Erscheinung und ihrem räumlichen Verhältnis zum Knaben der echten früheren Mutter Caterina“ (S. 137 f.).
Ganz gleich, ob nun wie von Freud der Zeitraum, den das Kind Leonardo mit seiner leiblichen Mutter allein oder überwiegend verbracht hat, rechtens mit drei bis fünf Jahren oder verkürzter angesetzt wird, an der außergewöhnlichen Tatsache seiner zwei jugendlichen Mütter ändert das nichts. Seine zwei in der Wirklichkeit jugendlich schönen Mütter hätte Leonardo folglich in das Phantasiebild der Anna und Maria hineingemalt. Und was er mit den beiden Müttern doppelt verherrlicht hätte, wie er es in beider seligem Lächeln in Vollendung zum Ausdruck gebracht hätte, das wäre im Wesentlichen die ungezwungene, reine Glückseligkeit einer menschlichen Mutter beim Anblick ihres männlichen Kindes gewesen, mag diesem Hochgefühl unverkennbar bei der reiferen, weiseren Anna auch ein wehmütiges Wissen über das harte Lebensschicksal eines jeden Menschen beigemischt sein, dass er sich von der Mutter trennen wird und dass er sterben muss. Damit würde Sinn und Ergebnis der Freudschen Deutung sichergestellt sein, selbst wenn sich herausstellen sollte, dass Einzelheiten seiner Konstruktion nicht haltbar wären, einzig er vermochte unter Anwendung des von ihm virtuos gehandhabten tiefenpsychologischen Instrumentariums eine solche verborgenste Schicht des berühmten Bildes aufzudecken. „Die heilige Anna, die Mutter der Maria und Großmutter des Knaben, die eine Matrone sein müßte, ist hier vielleicht etwas reifer und ernster als die heilige Maria, aber noch als junge Frau von unverwelkter Schönheit gebildet. Leonardo hat in Wirklichkeit dem Knaben zwei Mütter gegeben, eine, die die Arme nach ihm ausstreckt, und eine andere im Hintergrunde, und beide mit dem seligen Lächeln des Mutterglückes ausgestattet“ (S. 137).
Letzteres ist die Herzmitte dessen, was Freud in dem Bild dargestellt zu erkennen geglaubt hat, das „selige Lächeln des Mutterglücks“, die „Verherrlichung der Mütterlichkeit“ (S. 136), und nur soweit möchte ich ihm unbedingt folgen. Seine Ableitung des Lächelns mag fragwürdig bleiben. Er war überzeugt, Leonardo hätte das geheimnisvolle Lächeln, das er seither allen seinen Geschöpfen, männlichen wie weiblichen, berückend auf die Lippen gezaubert hat, unwiderstehlich als das halbvergessene seiner Mutter Caterina wiedererinnert, als es ihm bei Portraitierung der Mona Lisa leibhaftig von neuem begegnete. „Wir beginnen“, schreibt er, „die Möglichkeit zu ahnen, daß seine Mutter das geheimnisvolle Lächeln besessen, das er verloren hatte und das ihn so fesselte, als er es bei der Florentiner Dame wiederfand“ (S. 136). Im übrigen betonte er aber im Falle der „Mona Lisa“ durchaus den ambivalenten Charakter ihres Lächelns, wie man es hypothetisch mithin auch der leiblichen Mutter Leonardos zuschreiben müsste, wogegen im Bilde der „Anna Selbdritt“ davon doch gerade nichts zu sehen ist. Im Falle der „Mona Lisa“ hatte er, Walter Pater folgend, vom Doppelsinn ihres Lächelns gesprochen, dem „Versprechen schrankenloser Zärtlichkeit“ wie einer „unheilverkündenden Drohung“ (S. 139). Und danach hat er diese Charakteristik geschickt genutzt, um das Lebensschicksal des Künstlers tiefer aufzuschließen: „Die Zärtlichkeit der Mutter wurde ihm zum Verhängnis, bestimmte sein Schicksal und die Entbehrungen, die seiner warteten. Die Heftigkeit der Liebkosungen, auf die seine Geierphantasie deutet, war nur allzu natürlich; die arme verlassene Mutter mußte all ihre Erinnerungen an genossene Zärtlichkeiten wie ihre Sehnsucht nach neuen in die Mutterliebe einfließen lassen; sie war dazu gedrängt, nicht nur sich dafür zu entschädigen, daß sie keinen Mann, sondern auch das Kind, das es keinen Vater hatte, der es liebkosen wollte. So nahm sie nach der Art aller unbefriedigten Mütter den kleinen Sohn anstelle ihres Mannes an und raubte durch die allzu frühe Reifung seiner Erotik ein Stück seiner Männlichkeit“ (S. 139)
Nach Freuds Überzeugung wäre es Leonardo also erst mit dem Bildnis der „Anna Selbdritt“ gelungen, das selig-unselige Lächeln seiner Mutter, das er bei der „Mona Lisa“ wiedererinnert hätte, seines ambivalenten Charakters zu entkleiden und die reine Seligkeit irdischen Mutterglücks verklärend zu verherrlichen: „Die Großmutter hat den einen unverdeckten Arm in die Hüfte gestemmt und blickt mit seligem Lächeln auf die beiden herab. Die Gruppierung ist gewiß nicht ganz ungezwungen. Aber das Lächeln, welches auf den Lippen beider Frauen spielt, hat, obwohl unverkennbar dasselbe wie im Bilde der Mona Lisa, seinen unheimlichen und rätselhaften Charakter verloren; es drückt Innigkeit und stille Seligkeit aus“ (S. 136 f.).
Demzufolge hätte Leonardo mit diesem Meisterwerk der von ihm als Kleinkind beglückend erlebten Mutterliebe ein rühmendes Dankesmal gesetzt oder, so das zu personalistisch formuliert erschiene, mit diesem Bild eine allgemeine Apotheose menschlicher Mutterliebe geschaffen. Denn der argwöhnisch nüchterne Freud weiß natürlich besser als jeder andere: „Mit dem seligen Lächeln der heiligen Anna hat der Künstler wohl den Neid verleugnet und überdeckt, den die Unglückliche verspürte, als sie der vornehmeren Rivalin wie früher den Mann, so auch den Sohn abtreten mußte“ (S. 138). Auch in diesem Falle wäre demnach, trotz der brillant durchgeführten Ableitung des Werks aus Person und Lebensschicksal des Künstlers, am prinzipiellen Illusions- und Wunschtraumcharakter jedweden großen Kunstwerks nicht zu zweifeln, was abzustreiten auch Freuds Diagnose der Kunst als „milder Narkose“ (Das Unbehagen in der Kultur, S. 212) weltenfern lag. In unserem Bild hätte Leonardo die von ihm wirklich erlebte Mutterliebe mit einer ausgedacht idealen Mutterliebe zur vollkommene Einheit beider erhöht, in solcher Vollendungsform zu malen verstanden und als wünschbarste Möglichkeit erfüllten Menschseins seinem Publikum vorgeführt.
Zur damaligen Zeit wurde aber dergleichen Traumbild, wie noch selbst von einem Leonardo ganz selbstverständlich, in Gestalt der Maria Muttergottes gefeiert, einer von keinem Makel der Sexualität befleckten, allzeit jungfräulich-reinen und allerschönsten Mutter, die nach treuherzig christlichem Glauben ihr ganzes Leben und ihre ganze Liebe einzig und allein ihrem Sohn gewidmet hatte. Etwas von solch unbedingter Mutterliebe müsste Leonardo zu Anfang seines Lebens erfahren haben, danach wäre ihm dieser Schatz in der Erinnerung abhanden gekommen, in seiner Kunst hätte er ihn wiedergefunden und ihm Gestalt zu geben vermocht. Was Freud für den Dichter formuliert hat, hätte selbstverständlich ja auch für den bildenden Künstler Geltung: „Ein starkes aktuelles Erlebnis weckt im Dichter die Erinnerung an ein früheres, meist der Kindheit angehöriges Erlebnis auf, von welchem nun der Wunsch ausgeht, der sich in der Dichtung seine Erfüllung schafft“ (Der Dichter und das Phantasieren, S. 177 f.).
Die überzärtliche Mutter seiner frühen Kindheit wäre demzufolge Leonardos Leben beherrschendes erotisches Erlebnis geblieben, das seine gesamte sexuelle Konstitution festgelegt hätte, seine homosexuellen Neigungen wie die wohl früh einsetzende, vollständige sexuelle Inaktivität, verbunden mit ausgesprochenem Abscheu vor den Sexualorganen. Doch mittels seiner Kunst hätte er das einstmals erfahrene, beseligende Geschenk zärtlichster Mutterliebe dankbar in ein Hochbild völlig ambivalenzfreien Mutterglücks zu verklären vermocht, das selbst durch das schmerzhafteste Wissen um den unvermeidlichen Tod des geliebten Kindes, an den sie es zugleich mit seiner Geburt überantwortet hatte, nicht wirklich hätte beeinträchtigt werden können. Die Mutter Maria im Bild der „Anna Selbdritt“ bezeugt ungeschmälertes Mitgefühl und liebevolle Fürsorge für ihr Kind, die sich in natürlichstem Verhalten äußert: Spontan greift sie, ohne zu zögern und groß nachzudenken, nach ihrem Liebling, um ihn vor jedem Schaden zu bewahren. So bekundet sie liebevolle Teilhabe an seinem Tun, einzig ihr etwas wehmütig wirkendes Lächeln, das aber nichts von einer tieferen Beunruhigung verrät, sondern das stille Glück eines selbstlosen Mutterherzens zum Ausdruck bringt, das nichts kennt und höher schätzt als die Sorge um ihr Kind, verrät vielleicht etwas vom nie vollständig zu unterdrückenden Wissen, dass auch ihr Kind, wie jedes Kind, sich von ihr trennen wird und seinen eigenen Weg gehen muss – das ist allgemeines Menschenschicksal, dazu brauchte gar nicht das bekannte Lebensschicksal Jesu Christi bemüht werden. Vollends Gestalt geworden, meine ich, ist diese letzte Weisheit des Lebens, dass jeder Mensch allein zu sich selbst kommen kann, wenn er freigelassen wird, freigelassen auch zur Einwilligung in seine Sterblichkeit, im ernsten Gesicht und überlegen heiteren Lächeln der hl. Anna. Ahnungsvoll, bedeutungsvoll bezeugt sich darin die abgeklärte Gelassenheit einer reif gewordenen Seele, die sich, wie Leonardo selbst, in die Notwendigkeit und große Gesetzmäßigkeit der Natur und die Vergänglichkeit der menschlichen Existenz besonnen und souverän zu schicken gelernt hat. Mit den wissenden Augen einer Seherin blickt diese Große Mutter tief hinein in ihr Innerstes, um ihre Lippen spielen Verständnis und Güte. Selbst das leidvolle Bewusstsein von allen Abgründen des irdischen Daseins, von den heillosen Schrecknissen des Lebens und Sterbens, vermag den schließlich erlangten Seelenfrieden nicht mehr zu gefährden. Dem Leben ist sein Lauf zu lassen, es ist schön und gut trotz allem und allem – aber man mischt sich nicht mehr hinein.
Mit seiner „Anna“ wäre Leonardo daher nach meinem Urteil eine bewunderungswürdigste Versinnbildlichung dessen geglückt, was mit Carl Gustav Jung der Sophia-Archetyp der Menschenwirklichkeit genannt zu werden verdiente, die symbolisch weiblich zu wertende Weisheit des Lebens, die im nüchternen Wissen um Geburt und Tod bestünde und um die Krönung des menschlichen Daseins in Selbstverwirklichung und angenommenem Lebensschicksal. Die Landschaft, die das Haupt der heiligen Anna umgibt, mag diesen Eindruck abgeklärter Lebensweisheit bestätigen. Die fernen Berge und Nebel verhangenen Täler, das unwirkliche Gebirge, das nachgewiesenermaßen aber auf präzisen geologischen Kenntnissen Leonardos beruht, die verwischten Einzelheiten: All das zusammen vermag die Vision einer über alles Menschliche erhabenen Geist-Landschaft zu vermitteln, in der die Gegensätze von Freud und Leid und von Leben und Sterben aufgehoben erscheinen, ein Sinnbild der befreienden Lösung aller Welträtsel im Sinne der von Freuds Todestrieb verhängten Rückkehr ins Anorganische, wie sie als der Weisheit letzter Schluss wohl auch im Buddha-Lächeln der hl. Anna bekundet wird, um dessen abschließende Gestaltung sich vielleicht noch die rätselhaften Chaos-Bilder Leonardos bis zuletzt bemüht haben, aus denen alles Menschliche restlos, ohne auch nur Spuren hinterlassen zu haben, ausgetilgt erscheint (vgl. hierzu Eisler, S. 268 ff., 295 ff.). Das Visionär-Weltüberlegene in Landschaft wie Lächeln lässt alles Vordergründig-Endliche verschwinden, Leonardo wäre damit, wenn es so paradox zu sagen erlaubt ist, eine Art nicht bedrohlicher, sondern befriedender Apokalypse geglückt. Mit dem geheimnisvollen Lächeln der hl. Anna hätte Leonardo der Nachwelt sein ureigenstes Symbol für eine befreiende Lebensanschauung hinterlassen, mit der sich der Mensch wissend und willig in das große Spiel der Natur von Notwendigkeit und unausdenkbaren Zufälligkeiten zu fügen vermöchte, dankbar für das Geschenk des Lebens, wofür er ihm seinen Tod schuldet, wie ihn der Jesusknabe gemäß ikonographisch orthodoxer Deutung des Bildes ebenfalls demütig auf sich genommen hätte. Abgeklärt weiß die Große Mutter Anna um dies bittere Los aller Erdenwesen, aber nimmt ihnen die Furcht vor nur ausgedachten Zukünften und heißt sie, seelenruhig und heiter der Gegenwart zu leben. Es wäre die befreiende Gunst der mütterlich übermenschlichen Natur, die aus der hl. Anna dem Betrachter weise zulächelte: Alles Lebendige auf Erden wird geboren und muss sterben, aber in der kurzen Spanne Zeit, die ihm im Licht zu leben vergönnt ist, sollte es sein Leben lieben lernen und das unerbittliche Schicksalslos umsichtig annehmen.
Solch metaphysische Einsicht in die irdisch menschliche Wirklichkeit, mit der Leonardo, meine ich, zu Recht die Weisheitsgestalt der Frau ausgezeichnet und geistvoll geschmückt hat, ist in der Malerei der Hoch-Renaissance ansonsten kein zweites Mal erreicht, vielleicht nicht einmal erstrebt worden, sie blieb sozusagen Sondergut von Leonardos einmaliger Geisttiefe, obwohl auch ansonsten bei Verherrlichung der Mutterliebe in der Renaissance-Kunst ein Höchstes geleistet worden ist und ebenfalls zielsicher die genaue weibliche Entsprechung zum männlichen Heros in der Venusgestalt gefunden wurde. Zur Illustration dieser Ansicht nutze ich hauptsächlich eines der zahlreichen berühmtesten „Madonnen-Bilder“ Raffaels, doch die bezeichnendste Versinnbildlichung der Frau ist von den Renaissance-Malern nicht länger mit Gemälden der Madonna verwirklicht worden, sondern nach Ansicht von André Malraux, der ich mich anschließe, mit berühmtesten Darstellungen der nackten Venus, hier repräsentiert durch zwei Gemälde von Giorgione und Tizian.
Das Ideal der Madonna, das bedeutendste Symbol des geistigen Abendlandes, ist seit der byzantinischen „Theotókos“ großen Wandlungen unterlegen gewesen, auf die an dieser Stelle nicht eingegangen zu werden braucht, da sie im Maria-Kapitel ausführlich behandelt werden. In der Hohen Gotik hatte das Verehrungsbedürfnis der Gläubigen Maria bis zu den Sternen erhoben, sie als Königin des Himmels gefeiert, von ihrem göttlichen Sohn dazu gekrönt, eine mächtige und liebevolle Beschützerin und Fürbitterin, deren mütterlichem Herzen man sich in zärtlicher Anhänglichkeit und kindlichem Vertrauen anheimgeben konnte. In der Renaissance ist auch diese fast zur Göttin erhöhte Gestalt auf die Erde zurückgeholt worden, zunehmend wurden ihr menschlichere Züge verliehen, am Ende erhielt sie das idealisierte Gesicht der eigenen Geliebten. Zunächst heißt „Madonna“ ja gar nichts anderes als simpel „mia donna“, „meine Frau“, eigentlich „Haus-Frau“, abgeleitet von lat. „domina“, worin „domus“ = „Haus“ steckt. Dieser Name hatte daher längst zur Bezeichnung der geliebten Frau gedient, ehe der geläufige Ausdruck zum bevorzugten Titel von Maria wurde. Verehrt als Mutter Jesu, dürfte die Madonna selbst noch für die Renaissance-Maler das häufigste Bild-Motiv gewesen sein, Leonardo, Michelangelo und zumal der Innigste aller Madonnen-Maler, Raffael, haben ihr neben zahlreichen anderen Meistern in bedeutendsten Werken gehuldigt. Von gotischer Weltflüchtigkeit haftet allerdings den Darstellungen in der Hochrenaissance nurmehr wenig an, allesamt gleichen ihre Madonnen irdischen Frauen, die aber geadelt erscheinen durch unvergleichliche Schönheit.
Von Leonardo wäre insbesondere die sogenannte „Felsengrotten-Madonna“ aus dem Louvre zu erwähnen, (Abbildung) gemalt wohl in den Jahren 1483-1485 oder auch später, die meisten Datierungen der Werke Leonardos sind nach wie vor unsicher. Trotz der unübersehbar in dem Bild vorhandenen mysteriösen Anspielungen, wodurch die abgebildeten Personen aufeinander in Bezug gesetzt sind – was bedeutet beispielsweise der geheimnisvoll wunderschöne Engel, der sich halb aus dem Geschehen heraus- und dem Betrachter zuwendet, und warum weist er so bedeutend-rätselhaft ausgerechnet auf den Johannesknaben? –, wirkt die zentrale Figur der Maria wie ein vorwiegend irdisches Wesen von schlichter Anmut und keuscher Jugendlichkeit. Schützend umfasst sie den Johannesknaben mit Hand und Mantel, ihre Linke schwebt behutsam, wie segnend, über dem Jesuskind – wieder, würde Freud sagen, handelt es sich um eine idealisierende Gestaltung mütterlicher Liebe, mag Leonardo die in seiner Kindheit nun entbehrt oder überreich erfahren haben oder wohl eher beides, ganz gleich. Überhaupt sollte bedacht werden, ehe solch psychologische Ableitungen von Idealisierungen aus dem persönlichen Lebensschicksal entrüstet von vornherein verworfen werden, dass, wie ungeklärt die Familienverhältnisse im Fall Leonardos auch sein mögen, bei den beiden anderen Großmeistern der Renaissance die Tatsachen einwandfrei feststehen: Michelangelo wie Raffael haben ihre Mütter in früher Kindheit verloren – Michelangelo ist kaum einen Monat nach seiner Geburt auf unbestimmte Zeit einer Amme anvertraut worden, lebte fortan getrennt von seiner Familie, seine leibliche Mutter starb, als er nicht einmal sechs Jahre alt war; Raffaels Mutter, über die ansonsten überhaupt nichts bekannt ist, starb, als ihr Sohn acht Jahre alt war.
Die Landschaft, in die Leonardo seine Madonna hineingemalt hat, mutet äußerst merkwürdig an. In der Hauptsache handelt es sich um eine Art Höhle oder Grotte, im Vordergrund ist ein Rasenstück zu sehen mit einigen wunderschön gemalten Blumen. Ansonsten fehlt jede Andeutung von Leben, kein Mensch, kein Tier stört die mystische Stille der Szenerie. Abermals drängt sich mir die Deutung einer Epiphanie, diesmal der bergend schützenden, alles Leben zum Gedeihen segnenden Mutter Natur auf, wie sie Leonardo öfters in seinen Naturforschungen in einigermaßen pantheistisch anmutenden Worten gerühmt hat. Dmitri Mereschkowski gibt in seinem Leonardo-Roman (Leonardo da Vinci, S. 375) eine ansprechende, vielleicht nur etwas zu pathetisch geratene Deutung des Bildes: „Die Himmelskönigin erschien hier den Menschen zum ersten Mal; im geheimnisvollen Dunkel der unterirdischen Höhle, die vielleicht einst dem alten Pan und den Nymphen als Zufluchtstätte gedient hatte, saß hier die Mutter des Gottmenschen am Herzen der Natur, in den Tiefen der Mutter Erde, ein Geheimnis aller Geheimnisse“.
Geheimnisvoll wirken die Madonnen Michelangelos nun wahrlich nicht, anstatt dessen erscheinen die Gesichter der „Pietà“ aus dem Petersdom (Abbildung) wie auch der sogenannten „Brügger Madonna“ (Abbildung) mit anmutigster Schönheit beschenkt, die Michelangelo in späteren Jahren nicht mehr erreicht oder nicht mehr erstrebt hat. Den gewünschten Effekt durch Idealisierung und nahezu aufgenötigte Bewunderung zu erreichen, war demnach die unverkennbar leitende Absicht des Künstlers, gleichwohl ist auf Andeutungen von Übernatürlichem Verzicht geleistet. Wie bei Skulpturen fast zwangsläufig fehlen hier Heiligenschein oder ähnliches, aber dergleichen fand sich auch auf Bildern Leonardos mitunter bereits nicht mehr, beispielsweise sollen Heiligenscheine und Kreuz in die Londoner Fassung der „Felsengrotten-Madonna“ erst später hineingemalt worden sein (vgl. Woldemar von Seitlitz: Leonardo da Vinci, S. 127). Was Michelangelo mit seinen Skulpturen vor die staunenden Augen des Publikums zaubern wollte, waren jugendliche, über alle Maßen schöne Frauen und Mütter, in stiller Trauer die eine angesichts des Leichnams ihres Sohnes, aber gelassen im Wissen um das Unvermeidliche, so dass kein Schmerz ihre Züge zu verzerren braucht; tief in Gedanken die andere, noch schwankend zwischen Beglückung und Traurigkeit, da sich das Kind aus ihrem Schoß gelöst hat und von ihr wegstrebt, ein noch harmloser Beginn, der aber im Opfertod enden wird, wie die prophetische Mutter weiß.
Ohne Frage hätte sich also in beiden Fällen, bei Leonardo wie bei Michelangelo, trotz hinzugewonnener menschlicher Nähe ihrer Madonnen, der Kunstsinn der Meister, mag sein, in ungewohnter, neuartiger Weise, noch in den Bahnen der traditionellen theologischen Vorgaben bewegt. Und diese Behauptung würde selbstredend auch für Raffael Geltung beanspruchen, wie ich mit Deutung der „Sixtinischen Madonna“ im Maria gewidmeten Kapitel eingehender nachzuweisen versuchen werde. Aber Raffael hat das heilige Mutterglück noch geflissentlicher als seine beiden Vorgänger sozusagen in praller Weltlichkeit vorführen wollen, so dass man erst belehrt werden müsste, so man nicht in der selbstverständlichen christlichen Tradition stünde, dass natürlich doch die Gottesmutter gemeint ist, auch wenn Heiligenschein et cetera völlig fehlen – zur Illustration habe ich als Beispiel die populäre „Madonna della Sedia“ (Abbildung) ausgewählt.
Als höchsten Ruhmestitel der Kunst Raffaels möchte ich in Anspruch nehmen, dass ihm wie mühelos geglückt ist, die Erde und alle ihre Geschöpfe, aber in erster Linie den Menschen, mit der Gunst bis dahin unerreichter Schönheit zu beschenken und zu einer Vollkommenheit zu verklären, die ungeteilte Bewunderung verdient. Neben einer Welt von Geschöpfen geheimnisvoller Tiefe wie bei Leonardo und der erhabenen Größe Michelangelos erschuf Raffael sich seine Welt und Wirklichkeit ungezwungener Anmut und Noblesse, worin der solchermaßen erhöhte Mensch keines transzendenten Gottes mehr bedurfte, sondern selber in einen „alter deus“, einen „Gott der Erde“ verwandelt erscheint. Seinen Bildern gehen daher sowohl die rätselhaften Dunkelheiten Leonardos ab, das Unergründliche von dessen Figuren, als auch die ungeheuerlichen Ausblicke, die sich zumal beim späten Michelangelo auf Leid und Verhängnis im Menschenleben auftaten. „Man muss die Menschen malen, wie sie sein sollen“, wird ein berühmt gewordenes Wort von Raffael überliefert – mithin hat er mit seinen Bildern einen wunderschönen Traum gemalt, mittels dessen der Mensch sich in eine heiter vornehme Vollkommenheit hineingewünscht hätte, von aller Schwere und Düsternis seines todgeweihten Daseins wie erlöst, aber ohne der Erde metaphysisch abgeschworen zu haben.
Bei der „Madonna della Sedia“ wirkt schon die Ungezwungenheit, die geniale Treffsicherheit in der Komposition schlechthin bewundernswürdig, mit der hier die Mutter mit dem Kind auf ihrem Schoß und dazu noch der Johannes-Knabe in das Kreisrund des Tondo-Formats hineingezaubert sind – Raffael dürfte damit die ultimative, wohl nie übertroffene, wohl unübertreffbare Verwirklichung der Tondo-Idee gelungen sein, der Bild gewordenen Symbolik in sich geschlossener Einheit, in der die Teile sich harmonisch zum Ganzen runden. Und geglückt zu sein scheint ihm das sozusagen wie von selbst, beiläufig, „natürlich“, ganz und gar stimmig: die mustergültig adäquate Gestaltung von äußerer Form und geistigem Gehalt eines Bildes. Denn wie das Rund des Formats die Figuren zusammenfügt, so schließt die Mutter mit schützenden Armen und überkreuzten Händen das Kind auf ihrem Schoß in den hermetischen Kreis ihrer Liebe und Sorge ein, indem sie ihm den treuen Schutz ihres Leibes gewährt – das linke Bein ist hochgestellt, es stützt das Kind, soll es schützen vor jeder drohenden Gefahr und allem Grimm des Daseins, auch der Johannesknabe darf sich der bergenden Rundung nicht entziehen. Das Jesuskind schmiegt sich eng an die Brust der Mutter, sein Köpfchen hat es vertrauensvoll an ihre Wange gelehnt, kann sich beruhigt und geborgen durch den Herzschlag ihrer Nähe und Wärme fühlen, sicher und selig in ihrem weichen Schoß und den fest um es geschlungenen Armen – mag auch das zukünftige Unheil seinem ahnungsvollen Blick nicht gänzlich verborgen bleiben können. Doch aus heilig geschenktem Urvertrauen und der Lebensgunst durch eine liebende Mutter heraus darf es ihm getrost entgegenleben. Ebenso scheint mir das Gesicht der Mutter etwas von einem stillen Wissen um das Schicksal ihres Lieblings auszudrücken, indes ihr ganzer Körper sich noch dagegen wehrt, zu halten und zu schützen sucht und das Kind ihre bedingungslose Liebe fühlen lässt – allenfalls hätten ihre über seinem Leib gekreuzten Hände, ihr unbewusst, ihm seine schreckliche, aber heilsam-notwendige Zukunft im Zeichen des Kreuzes auf den Leib gezeichnet. Gekleidet ist die Madonna im herrlich bunt gewebten, festlichen Gewand einer römischen Bäuerin, Leib und Glieder sind von mütterlicher Fülle. Prächtig sitzt sie da, voller Leben, ein reifes, schönstes Weib, eine bezaubernd junge Mutter mit einem wonnigen Kind auf ihrem Schoß, in dem alles Kreisen und Runden, Bergen und Schützen der Mütterlichkeit sein Zentrum und seinen Sinn findet, in dieser von prallem Leben strotzenden Frucht ihres blühenden Leibes. Ohne Frage ist es die Madonna, die Gottes-Mutter, die Raphael gemalt hat, aber nach Absicht des Renaissance-Künstlers soll dies lebensvolle, liebenswürdige Weib als Apotheose durchaus irdischer Mütterlichkeit gesehen und bewundert werden, als ein Non-plus-ultra edler, verehrungswürdiger Menschlichkeit – und welcher Mann würde sich solch schönstes Weib nicht zur eigenen jugendlichen Mutter oder zu seiner geliebten Frau in einem gesegneten Erdenleben wünschen?
Dass aber mit solchen Bildern das Transzendent-Göttliche im Grunde entbehrlich geworden und an seine Stelle die Feier von Erde und Mensch getreten war, die begeisterte Rühmung irdischer Schönheit und die wollüstige Bejahung des – zwar vergänglichen, aber in unbefangener Nacktheit liebreizenden – Erdenleibes, das wurde erst mit Ersetzung der toskanischen Madonna durch die Venus der Venezianer veranschaulicht. Wie vorangemeldet, folge ich hier dem mich überzeugenden Hinweis von André Malraux, dass von den Renaissance-Malern damals dem männlichen Mars, aufrecht stehend, zu Kampf und Sieg bereit wie Michelangelos „David“, zu ihm passend, die erotisch verführerische Venus ins Bett gelegt worden ist. Das Missverständnis, im Falle Marias immerhin nicht gänzlich ausgeschlossen, dass mit solcher Allerschönsten eine Göttin hätte bedeutet werden sollen, zumindest etwas Überirdisch-Übermenschliches von der Art einer Gottesmutter und Himmelskönigin, dürfte hier von vornherein und vollständig ausgeschlossen gewesen sein: Niemand hat vor der „Venus“ Botticellis oder Giorgiones oder Tizians anbetend das Knie gebeugt, ohne Zweifel war etwas anderes gemeint. Die Kunst der Renaissance, hat Malraux seine Ansicht zusammengefasst, „beschwört ... die beiden Hauptgottheiten der Bewunderung, die souveränen Gestalten des Mannes und der Frau: den Heros und Venus“ (2. Bd. Das Irreale, S. 125). Daher spricht er von einer die christliche ablösenden „profanen Fiktion“ (ebd.), „wo weibliche Figuren aufhören, Frauen zu sein, ohne deshalb Heilige zu werden, aufhören Heilige zu sein, ohne einfach Frauen zu werden“ (S. 124). „Venus, die keine Heroine ist, ist nichtsdestoweniger die weibliche Gestalt des Heros. Ihm, nicht Mars, entspricht sie. Und sie verkörpert eine strahlende Weiblichkeit, die der irrealen Männlichkeit des Heros verschwistert ist“ (S. 133). Die Kunst „erlöst ... die weibliche Figur von der Conditio Humana ..., ohne dabei das Reich Gottes in Anspruch zu nehmen“ (S. 135).
Demzufolge hätte Giorgione die Welt, die Frau mit wiedergeboren heidnischen Augen angeschaut und dem Eros zur Erdenschönheit und Nacktheit des Fleisches gehuldigt, dem erneuert der höchste Adel verliehen worden wäre, wogegen es der Christ als sündig zu verhüllen trachtete und es entblößt als abstoßend darstellte. Augenlust triumphierte, die satte Farbigkeit der Venezianischen Meister erlangte einen zur Weltlust verführenden Reiz und Glanz wie wohl nie vorher und nie nachher. Doch deswegen ist die gepriesene, nackte Sinnlichkeit keineswegs schwül oder gar gemein vorgeführt worden, sondern sie wirkt frisch, ja keusch, ja auf eine neue Art heilig – zumindest bei der berühmten „Geburt der Venus“ von Botticelli in den Uffizien (1485) und vollendet bei der „Ruhenden Venus“ von Giorgione aus dem Jahre 1520 (Abbildung) hat es für mich diesen Anschein, zu bewundern in der „Dresdner Gemäldegalerie“. Vielleicht schlummernd, träumend, liegt das völlig nackte Weib lang ausgestreckt da. Bequem ruht sie auf weichem Pfühl, aber auf blumiger Wiese in eine stille Landschaft gebettet. In wunderbarer Entsprechung zur Reinheit und Schönheit des Frauenkörpers gibt diese den farbigen Rahmen ab für einen Akt, der an ein Still-Leben denken lässt: Ein schönster Glanz der Erde, ein Strahl aus ihrem Herzen von Gold sozusagen, mit Nietzsche zu sprechen, und als Glück verheißendste Verführung zu ihr, zumindest mit den Augen des Mannes gesehen: die Brüste der Frau, schön und nützlich zugleich. Das sanfte, von dunklem Haar umflossene Gesicht ruht friedlich, mit geschlossenen Augen, auf der rechten Armbeuge. Sollte das herrliche Weib schlafen, so könnte es nur ein ganz leichter Schlummer sein, für einen längeren, tiefen Schlaf erscheint die Stellung zu unbequem. Vielleicht lässt sich erraten, was sie, befriedigt, für eine kurze Weile die Augen hat schließen lassen. Denn leicht ruht die linke Hand noch auf ihrem Geschlecht, und wohl weniger, um es schamhaft zu bedecken – denn nur der gemein unwürdige Betrachter vermöchte sich diesem jungfräulichen Leib, seinerseits wahrlich schamlos, zu nähern, getrieben von lüsterner, rohsexueller Begehrlichkeit –, sondern sanft ermüdet vom süßen Spiel der Selbstbefriedigung, die Finger noch ein wenig gekrümmt von dem unschuldigen Vergnügen. Und so bieten der marmorweiße Leib, die runden Brüste, der füllige Bauch, die schlanke Gestalt ein betörendes Bild erotischer Verheißung und liebreizender Verlockung zum Begehren nach Erfüllung in Liebe und Lust, ein enthusiastisches Versprechen von Genuss und Glück der Erde. Bestimmt entfaltet nur so, liegend, die weibliche Nacktheit ihren ganzen, unwiderstehlichen Liebreiz, wogegen der männliche Akt sich am besten stehend zur Geltung bringt. Im übrigen will mir diese Venus Giorgiones aber gänzlich unnahbar erscheinen, unberührbar, nur ein heiliges Versprechen der Gunst des Lebens, aber nicht mehr, weil sie kalt und spröde wirkte wie noch diejenige von Botticellis toskanischer „Geburt der Venus“, sondern weil in ihr eine heilige Harmonie von Natur und Mensch beschworen wird, eine Verwandlung in etwas Geistig-Gottgleiches, in ein Stück Arkadien, das nicht betreten werden darf und kann, sondern für immer ein Wunschbild der Ferne bleibt. Aller Erdenliebreiz scheint mir hier zur Bewunderung in Eins verschmolzen, würdig eines unendlichen erotischen Entzückens im Anblick der Schönheiten dieser Welt, eines reinen Genießens im Anschauen, ohne Gier nach Besitz, sondern nur wollüstige Schau des Schönsten, was sich wenigstens männlichen Augen als einigendes Symbol aller Erdenschönheit darbietet, zu ungeteilter Bejahung durch ihn und zu seiner eigenen Bejahung, zur „Zeugung im Schönen“, wie sich Platon ausgedrückt hatte: Das schöne Bild des jungen, reizend nackten Weibes.
Tizian in seinem so ähnlich aussehenden Bild der sogenannten „Venus von Urbino“ aus dem Jahre 1536 (Abbildung) hat diese Sphäre rein-erotischer Offenbarung des Liebreizes irdischer Schönheit bereits hinter sich gelassen. Nicht von ungefähr ist seiner Venus nachgesagt worden, zum Modell habe ihm dabei eine Kurtisane gedient. Alle Unnahbarkeit der Natur, ihr In-sich-Ruhen, ihre Heiligkeit noch im nacktesten Fleisch der Frau, scheint aus seinem Bild verschwunden zu sein. Die unberührbar stille Landschaft Giorgiones ist in ein prächtiges Zimmer verwandelt, Venus hat die Augen geöffnet, der Kopf ist leicht angehoben, als sei ihre Aufmerksamkeit soeben durch den Betrachter geweckt worden. Zwar mag ihr Blick noch etwas verschleiert wirken, vielleicht hat ihre Hand ihr wieder die gleiche Befriedigung verschafft wie im Bild Giorgiones. Doch schon sucht sie herausfordernd zu verführen, weist kokett ihr gelocktes Goldhaar, lädt mit verhangen sinnlichem Blick den Betrachter oder Besucher ein, sich ihr zu nähern, ihr die gleiche Lust zu schenken, die ihre Nacktheit ihm frivol verspricht. Die Erfahrene, so jung sie noch ist, kennt das wollüstige Spiel der Liebe, ungleich verführerischer lockt sie dazu als Giorgiones keusche Venus. Das Zimmer scheint vor sexueller Erotik zu knistern, mag auch der Vorhang den angesagten Liebesakt, zu dem alles reizt, noch vor den Dienerinnen abschirmen. Wann und von welchem Maler wäre je ein liebreizenderes Bild sexueller Bereitschaft der Frau für den Mann, ein alle Liebeswonnen weich versprechender Leib, ein mädchenhaft unschuldiger und zugleich um die eigene Verführungskraft wissenderer Blick geschaffen worden als hier von Tizian mit diesem offenherzigen Lustversprechen rosigen Fleisches einer venezianischen Kurtisane? Eine leidenschaftlichere Bejahung und Verheißung der Wonnen, die das Diesseits dem Menschen zu spenden vermöchte, erscheint kaum noch möglich, wobei der sichtbare Leib zum Spiegel der verborgenen Seele geworden wäre.
In gewisser Hinsicht hat Rembrandt diese von den Renaissance-Malern bewundernswert gemeisterte Verbildlichung des Inneren aber noch überboten, seine Bilder von Alltäglichem, ja Hässlichem erscheinen wie von innerer Schönheit durchleuchtet und auf diese Weise geistig geadelt. Daher war es diesem Meister der Meister vergönnt, jenseits des Schönheits- und Vollkommenheitsideals der Renaissance-Künstler noch dem Vergänglichkeitswesen allen geborenen Lebens, zumal des Menschen, rühmlichen Ausdruck zu verschaffen – vielleicht lässt sich, was ich meine, durch Betrachtung und Deutung eines seiner Selbstportraits verdeutlichen, ich wähle das aus dem Jahre 1658 aus. (Abbildung)
Der Körper ist der eines alten Mannes, gehüllt in ein kostbares Phantasiegewand. Das Gesicht, die Hauptsache, wäre im landläufigen Sinne wohl kaum schön zu nennen, allenfalls im Sinne von schön durch Vergeistigung, als Spiegel einer alten Seele. Michelangelos „David“ war als ein Körper von schwellender jugendlicher Kraft dargestellt gewesen, jeder Zoll das Zeugnis von Mut und Siegesgewissheit, ein Sinnbild strotzend gespannten, gegenwärtigen Lebens. Auch sein „Moses“ zeigte keine Spur von Hinfälligkeit oder seiner Vergangenheit, sondern übermächtige, lebensvolle Geistes- und Willenskraft, angesichts derer sich die gewöhnlichen Menschen klein und hässlich vorkommen müssten. Die Maria seiner „Pietà“ besticht durch jungendlich-straffe Züge, keinerlei Zeichen heftigen Schmerzes entstellen das feine Gesicht, das mit seiner jungfräulichen Glätte über alle Sterblichkeit triumphiert, genauso wie das der sinnenden „Brügger Madonna“ gelingt, völlig in sich versunken. Über alles elende Menschenschicksal und Ausgeliefertsein an Zeit und Tod scheint ebenso Leonardos „Anna“ erhaben, ihr weises Lächeln spiegelt ein gelassenes Wissen um die allgemeine Notwendigkeit allen Seins unter der Sonne wider, eine überlegene Gleichgültigkeit gegenüber jedem Einzelschicksal, und wird so zum Ausdruck eines souveränen Sieges über alle Vergänglichkeit. Den gleichen Zustand harmonischen Ausgleichs erreicht Raffael mit seinen Bildern einer ideal schönen Zweieinheit von Mutter und Kind, in die nirgends ein Gran Unvollkommenheit eindringen könnte oder der Gedanke an Alter und Siechtum, genauso wenig wie in das blühende Fleisch der Akte von Giorgione und Tizian, hohe Feste der Lebensbejahung allesamt, aus der jeder Argwohn hinsichtlich Unzulänglichkeit und Endlichkeit ausgemerzt erscheint. Sterblichkeit wie Elend des Menschen werden verdeckt von lebendigsten, scheinbar ewig schönen Ideal-Gestalten, das Leben in seiner herrlichsten Blüte gefeiert, Zeit und Tod verleugnet, obwohl sie dem Erdenleben doch wesensmäßig genauso zugehören wie dessen jugendlichste oder reifste Vollkommenheitsfiguren.
Ganz im Gegensatz dazu hat sich Rembrandt in seinem Selbstbildnis keineswegs um seine Erhöhung im Sinne eines äußerlichen Schönheitsideals bemüht, sondern er hat seinen Alltagsleib gemalt mit schwammiger Nase und schlaffer, altgewordener Haut. Keine überirdisch schöne Madonna ist dargestellt, kein kühner Held, kein Heiliger, kein übermenschlich-großer Prophet, sondern ein an sich schlichter, gewöhnlicher Sterblicher. Hatte der Renaissance-Maler Realität und Individualität mit seinen Bildern zu erreichen versucht, indem er nach einem Modell malte, den Zügen der Madonna womöglich die vertrauten seiner Geliebten verlieh, diese aber unweigerlich ins Ideale erhöht und geschönt hatte, so sollte nachgerade das ungeschönte äußere Erscheinungsbild Aufmerksamkeit und höchstes Interesse erregen, mithin wurden auch dessen hässliche und gewöhnliche Eigentümlichkeiten in den Bildern nicht länger verleugnet, mögen sie letzten Endes auch wieder aufgehoben worden sein in der Totalität einer geistig-seelischen, nach außen gewendeten innerlichen Schönheit, die wenigstens Rembrandt seinen Portraits, auch gerade seinen Selbstportraits, zu verleihen gewusst hat. Und das scheint ihm dadurch gelungen zu sein – und damit eine zuvor ungeahnte Bejahung auch der nicht idealen, nicht zeitenthobenen, sondern ungeschminkten und der Vergänglichkeit unterworfenen menschlichen Wirklichkeit –, dass er die Zeit, die Vergangenheit eines Menschen, sein Schicksal, seine Lebenserfahrungen, sein Altern und gereiftes Wissen um das unausweichliche Ende in sein Gesicht hineingemalt hat, das Dokument der Geschichte einer Seele.
So geschehen auch wohl in dem Selbstbildnis von 1658, das Rembrandt folglich im Alter von 52 Jahren gemalt hat, schonungslos und äußerlich ungeschönt. Unübersehbar blickt einen das Gesicht eines frühzeitig gealterten Mannes an, fast schon eines Greises. Und ins Ideal-Schöne ist es wahrlich auch nicht gesteigert, sondern wirkt auf den ersten Blick eher gewöhnlich, ja abstoßend, mit Doppelkinn, Augensäcken, faltiger Haut und knolliger Nase, wie aufgedunsen. Anscheinend war Rembrandt nichts mehr an den überkommenen idealistischen Schönheitsstandards gelegen, denen die Renaissance gehuldigt hatte. Ungerührt betont und überbetont er das Plebejisch-Hässliche, das ästhetisch Fragwürdig-Individuelle, Ergebnis von Natur und Schicksal, aber bezeugt dadurch eine Sensibilität für das Unverwechselbar-Einmalige, die wohl nur selten übertroffen worden ist – in der Portrait-Kunst darf Rembrandt wohl als ein Meister der Meister gelten. Allerdings nicht deswegen, weil es ihm, auch mit seinen über hundert Selbstportraits, nur einfach gelungen wäre, Unscheinbar-Hässliches, anspruchslos Bürgerliches und Profanes auch für die Portrait-Kunst sozusagen hoffähig zu machen, wie es die Niederländer zuvor schon mit anderen Sujets des Alltags geschafft hatten. Vielmehr hat Rembrandt eine Dimension der Schönheit entdeckt oder eine innerliche Schönheit zumindest in einer geistigen Tiefendimension wiederzugeben vermocht, die alle vorherige ideale Schönheit in den Schatten gestellt hat.
Zum versuchten Nachweis beginne ich mit der Beschreibung beim Äußeren des Selbstbildnisses von 1658, mit Kleidung und Haltung! Das Gewand, in prächtigen Braun-, Gold- und Rottönen gehalten, dazu ein kostbarstes Weiß, mag zwar nur zum Phantasiekostüm eines eitlen Malers dienen, aber aufgrund der unvergleichlichen Farbgebung erscheint es eines Königs würdig. Und wie ein König sein Szepter, so hält der Maler seinen Pinsel: Majestätisch sitzt er wie auf einem Thron, eine massige, Ehrfurcht heischende Gestalt, ein Fürst der Maler, könnte man sagen. So wie Rembrandt hier in seiner Person einem ganzen Stand, der – poesielos betrachtet – nichts als Dienste seiner Kunstfertigkeit für eine kleine Schicht reicher Kaufleute leistete, den geistigen Adelsbrief des kreativen Menschen ausgestellt hat, so in ungleich bewegenderer Weise sich selbst durch die meisterliche Darstellungsweise dessen, worauf es bei einem Portrait schließlich ankommt, des Gesichtsausdrucks. Denn unweigerlich wird bei diesem Gesicht alles Hässlich-Gewöhnliche übersehen, man ist fasziniert von einem selbstbewusst-souveränen Geistadel, der schwer in Worte zu fassen, aber ganz unverkennbar ist. Das Antlitz gleicht einer Seelenlandschaft, in die das Lebensschicksal des Künstlers seine Spuren tief eingegraben hat, so dass alle erlebte Vergangenheit in der Darstellung lebendiger Gegenwart aufgehoben erscheint. Wie skeptisch, wissend, unergründlich, in unerschütterlicher Ruhe abgeklärtester Reife blicken die Augen aus diesem denkwürdigen Gesicht! Muss man nicht meinen, dass sich solch durchdringendem Wahrheitsblick des Malers alle Geheimnisse der Wirklichkeit entschleierten, nackt offenbaren müssten? Und wer vermöchte überhaupt vor solch lebenserfahrenen, prüfenden Augen zu bestehen? Wohlgemerkt: Ich bin keineswegs überzeugt, dass der 52-jährige Rembrandt diese Lebensmeisterschaft selbst tatsächlich besessen hätte, wie sie nach meinem Urteil durch sein Künstler-Selbstportrait bezeugt wird; dass er alle Schicksalsschläge, die aber ihre tiefen Spuren hinterlassen hätten, in unerschütterlicher Gelassenheit jenseits von Selbstmitleid und Überheblichkeit gemeistert hätte – vielleicht sind diese Selbstbildnisse ja in der Tat kaum mehr als eine Art Propaganda-Werke gewesen, die reicher Kundschaft zugeschickt wurden, sozusagen mit der Botschaft: Seht her, was ich kann! Was ich auch aus euch machen könnte! – die Perfektion des Seelengemäldes würde dadurch keine Einbuße erleiden.
Im Übrigen hatte das Leben Rembrandt wahrlich übel mitgespielt: Seine Frau Saskia war ihm allzu früh gestorben; drei Kinder hatte er wenige Wochen oder Monate nach ihrer Geburt begraben müssen. Dann hatte er sich mit der Amme seines etwas missgebildeten Sohnes Titus eingelassen, ihr die Ehe versprochen, das Versprechen aber nicht gehalten und vor den Gerichten nicht eher geruht, bis das arme Weib für Jahre ins Zuchthaus gesperrt worden war. Danach war die junge Magd Hendrikje Stoffels zu seiner Geliebten geworden, doch wegen des drohenden Geldverlusts an seinen Sohn – so hatte es nämlich das Testament Saskias im Falle seiner Wiederverheiratung verfügt – konnte er sie nie heiraten. Schließlich hatte er sich just zu der Zeit, als das Bild entstand, zum Konkurs gezwungen gesehen, musste seine reiche Sammlung von Kunstwerken, auch renommiertester Meister, sowie Kuriositäten aus aller Herren Länder versteigern lassen und sein Haus verkaufen. Zuletzt wird er sich, um weitere Verluste zu vermeiden, von der Geliebten und seinem Sohn pro forma anstellen lassen müssen, vielleicht auch, weil ihm nicht mehr zugetraut wurde, sein Leben noch selbständig führen zu können. Soll heißen: Gelegenheit zum Erwerb der Lebensmeisterschaft, zu abgeklärter, überlegener Weisheit des Alters, wie die Selbstbildnisse seiner letzten Jahre sie vor Augen führen, wären ihm durch sein Schicksal reichlich zuteil geworden. Doch ob ihm wirklich ein Jenseits vollständiger Gelassenheit gegenüber all diesen Schicksalsschlägen zu erreichen beschieden war, wie es durch sein Selbstbildnis als doppelter Anspruch eines Großen oder sogar Größten unter den Malern und zugleich weisesten Menschen anscheinend erhoben wurde, wage ich zu bezweifeln – weislich sollte man sich davor hüten, auf Grund der Könnerschaft, mit der Rembrandt den geistigen Adel des schöpferischen Menschen zu malen verstand, auf seine persönlich höchstrangige Menschlichkeit und Reife zu schließen. Die Affäre mit Geertge Dircx, der Hass, mit dem er sie und ihre Verwandten verfolgt hat, lässt seinen Charakter wahrlich in keinem günstigen Licht erscheinen: Er hatte wohl eher ein unangenehmes Wesen, war verschwenderisch, lebte ständig über seine Verhältnisse, war in zahllose Prozesse verwickelt, galt als Sonderling und als äußerst selbstgefällig. Letzteres darf wohl auch zur Erklärung der Unzahl seiner Selbstportraits mit herangezogen werden, in denen er sich in immer neuen Verkleidungen gefiel oder sich noch in seinen allerletzten Jahren zu Paulus, Demokrit oder Zeuxis hochstilisiert hat. Seine Selbstbildnisse als Zeugnisse völlig unzeitgemäßer Autonomie anzusehen, sie als eine Art gemalter Autobiographie anzuerkennen, wie es häufig bisher zu seiner Rühmung vorgebracht worden ist, so als ob hier jemand einmalig, unvergleichlich, einzig für sich selbst, in mutig-aufrichtiger Suche nach seiner ureigenster Wahrheit, der Kunst gelebt hätte, ohne Rücksicht auf irgendwelche Auftraggeber, das alles geht nachgerade nicht länger an, nachdem sich Rechenschaft darüber gegeben wurde, dass die Kunst im 17. Jahrhundert keineswegs Ausdruck innerer, persönlicher Überzeugungen der Maler gewesen ist, sondern eher derjenigen ihrer Auftraggeber. Rembrandt hat anscheinend kein einziges seiner Selbstportraits für sich zurückbehalten, sie also entweder allesamt verkauft oder – wahrscheinlicher – zur Werbung für seine Portrait-Kunst an Interessenten verschickt. Verklärung der Wirklichkeit, hier des eigenen Wesens darf daher auch in seinem Fall als künstlerische Absicht unterstellt werden, Selbsterhebung in den Geist-Adelsstand des schöpferischen Künstlers, der das innerste Wesen eines Menschen zu gefälliger Anschauung zu bringen vermöchte. Und das ist so vorzüglich ausgefallen, dass der Ruhm des Künstlers, der längst und zu Recht als einer der Allergrößten gilt, auf den Menschen Rembrandt abgefärbt und ihm den Ruf eines der seltenen ganz Großen der Menschheit eingebracht hat, woran mit guten Gründen gezweifelt werden mag, ohne deshalb seine letzten Werke als Ausdruck eines „für den Paralytiker charakteristischen euphorischen Glücksgefühls“ (W. Lange-Eichbaum: Genie, Irrsinn und Ruhm, München/Basel, 1979 (1967), S. 173) diffamieren zu müssen.
Rembrandt hat sich darauf verstanden, wie noch kein Maler vor ihm und vielleicht auch keiner mehr nach ihm oder unabhängig von ihm, den Geist- oder Seelenadel eines Menschen augenfällig zu machen. Mit seinen geradezu metaphysischen Brauntönen, im virtuosen Spiel von Licht und Schatten, im ausdrucksvollen Pinselstrich hat er es geschafft, das Innere nach Außen zu kehren, vielleicht sogar etwas vom Geheimnis eines Individuums zu erraten und zu verraten, von seinen Kämpfen, Siegen und Niederlagen oder zumindest die Möglichkeitsdimension solch innerer Erfahrungen sichtbar zu machen – und so wurde er zum eigentlichen, nie übertroffenen Maler der Seele, um es vereinfacht zu sagen. Jeder Schattierung von Gefühlen, Gemütsregungen und festen Charakterzügen, die in Worten überhaupt nicht wiederzugeben wären, hat er Ausdruck zu schaffen gewusst und mit seinen Portraits die Darstellung einer Dimension möglicher geistiger Reife hinzugewonnen, aufgrund derer sich noch das gewöhnlichste Gesicht zur würdigenden Bejahung des Individuell-Persönlichen verklären lässt. Ob Rembrandt selbst ein religiöser Mensch gewesen ist: Wer vermöchte das mit Sicherheit zu sagen? Aber seine Christus-Bildnisse vergegenwärtigen ergreifend eine sanft demütige Menschlichkeit, die schlechthin überzeugend wirkt, ob sie nun dem historischen Jesus zu Recht zugebilligt werden kann oder nicht. Oder: Wer würde sich seinen Gott mit einem anderen Gesicht als dem allbarmherzigen des Vaters aus Rembrandts „Heimkehr des verlorenen Sohnes“ aus seinen letzten Lebensjahren wünschen, damit er sich unbedingt sicher fühlen könnte im Glauben, am Ende würde er in Gnade und nachsichtiger Verzeihung trotz all seiner Verfehlungen wieder aufgenommen werden in den Armen eines liebevollen Vaters? (Abbildung)
Mit Bildern dieser Art und mit seinen Selbstportraits hat sich Rembrandts Kunst die Darstellung ungeahnter Möglichkeiten seelisch geistigen Menschseins, von Humanität und Menschenwürde erschlossen trotz entschiedener Abkehr von aller Idealisierung schöner Leiber. Und so hat er eine bewundernswürdige Heiligung des Alltäglichen und sogar Hässlich-Individuellen vollbracht, das, wie er wie kein zweiter zu sehen gelehrt hat, der Adelung durch den Künstler nicht zu entbehren brauchte. Ein Jeder kann sich dadurch herausgefordert fühlen, seinen ureigenen geistigen Möglichkeiten schöpferisch zur Verwirklichung zu verhelfen – „Reif sein ist alles“, wie der große Shakespeare es im „König Lear“ der Menschheit als seiner Weisheit letzten Schluss zum Vermächtnis anvertraut hat. Das Gleiche ließe sich nach meiner Überzeugung als Anspruch von Rembrandts Kunst behaupten und als mögliche Wirkung seiner Meisterwerke erhoffen. Danach wäre ihm ein Ja zur diesseitigen Wirklichkeit geglückt, wodurch das wieder gewonnene antike Ja der Renaissance noch überboten worden wäre: Die Welt, so wie sie ist, kann von der Kunst gesegnet werden, wenn es dem Menschen in seinem Leben gelingt, das, was er als Individuum sein kann, als Person wirklich zu werden, zur Reife zu kommen und allem übrigem gemäß seinen Möglichkeiten die Gunst zu schenken, es selbst zu sein, zu gedeihen – Rembrandt hätte dieser ethischen Möglichkeitsdimension in seinen Bildern symbolische Wirklichkeit zu geben vermocht. In Nachfolge der Antike hatte die Renaissance nur sozusagen die Blüte des menschlichen Wesens in eine Zeit enthobene, vornehmlich leibliche Schönheit verzaubert, wogegen Rembrandt den gewöhnlichen Menschen in eine Kunst geschaffene Möglichkeitssphäre geistiger Schönheit heimholte. Im metaphysischen Zeitalter des Abendlandes, das bis an die Schwelle der Neuzeit reicht und in Resten bis zur Gegenwart überdauert hat, schaffte es die Kunst – dank der Religion und theologisch begründet, d.h. orientiert am Hochbild Jesu Christi –, den Menschen durch die christlichen Jahrhunderte hindurch nach Maßgabe dieses hehren Vorbildes sowie des ihr eigenen Vermögens, diese Möglichkeitsdimension des Menschenwesens verklärend vor Augen zu stellen, mit ihren Mitteln und in den dadurch vorgegebenen Grenzen zu steigern, ihn zu bilden, ihn zu heiligen. Unüberwindbar sind diese Kunst geschaffenen Nachbilder menschlichen Wesens, des „wahren“ Menschen, so unterschiedlich sie in den Großepochen des christlichen Glaubens ausgefallen sein mögen, uniform mit den Selbstverständlichkeiten der abendländisch-christlichen Kultur im allgemeinen gewesen, Autonomie in dieser Hinsicht geht ihnen ab. Kunst wie Kultur überhaupt dienten selbstverständlich und selbstgefällig der Selbstbehauptung – aufs Wesentliche reduziert, hat also auch die große vergangene christliche Kunst mit ihrer Orientierung am Metaphysisch-Jenseitigen zu Vorteil und Nutzen der unveräußerlichen Lebensertüchtigung ihr Teil beigetragen, zum Standhalten auf Erden und zu diesseitiger Existenzsicherung scheinbar um des Himmels willen. Seit Beginn der Neuzeit hat es die Kunst im Gleichschritt mit der sie begründenden und tragenden Kultur vermehrt übernommen, sich zwecks Erfindung möglichen Menschseins den Umweg über den Glauben ans Jenseits, an Gott und seine Gnade zu versagen und sich direkt an der Aufgabe versucht, Sicherung und Steigerung von Diesseits und Mensch durch Schaffung des Ideal-Vollkommenen zu leisten, in der Renaissance mittels Fiktion des eher leiblich Vollkommen-Schönen, bei Rembrandt des eher Geistig-Seelisch-Schönen, und grundsätzlich sollte damit eine wohlmeinend ansprechende Bejahung des Diesseits und seiner selbst erreicht werden.