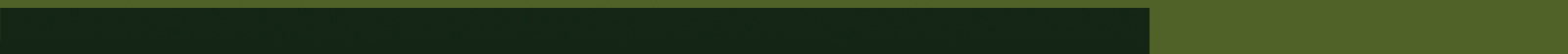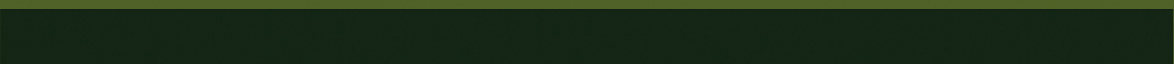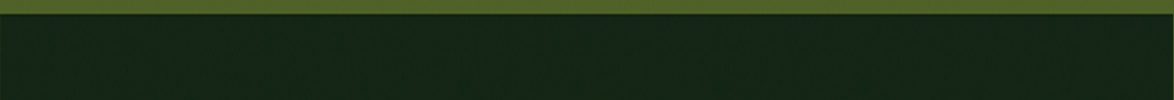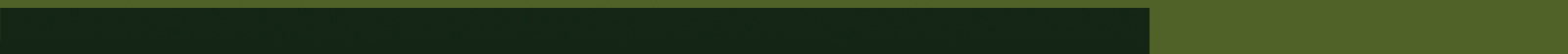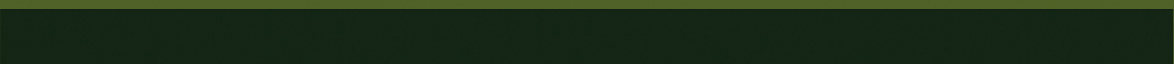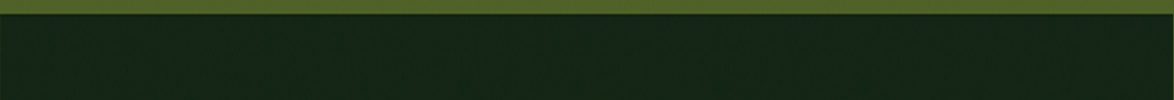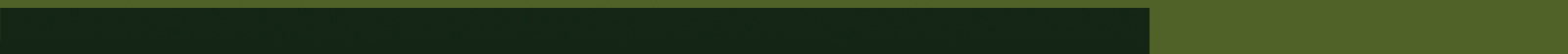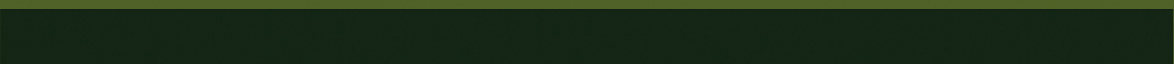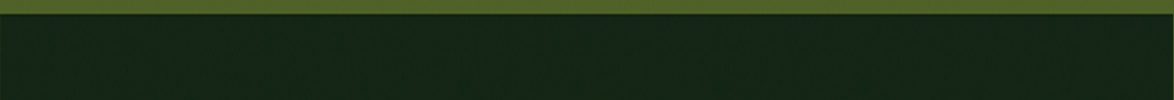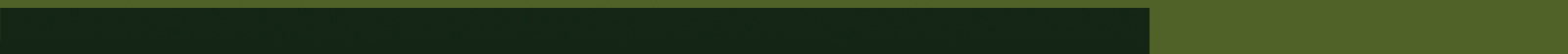
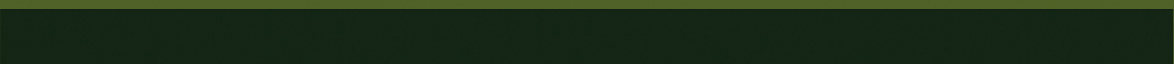
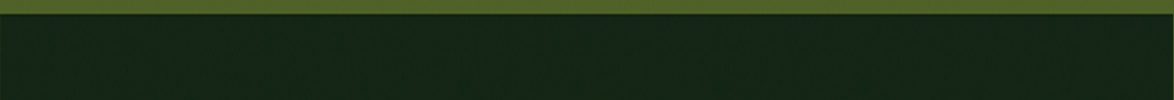
G Ö T T E R B I L D N I S S E
Z e u s / P o s e i d o n
Im Folgenden möchte ich versuchen, einige Götterbildnisse aus der klassischen großen Zeit als solche Stimulantia zum liebwerten Diesseits durch die Vergötterung der Schönheit zu deuten – denn aller Eros hängt doch zuletzt am Schönen. Ohne Zweifel sind diese Götter nur Gebilde der Phantasie, Wünschbarkeiten, Schönheitsideale gewesen. Doch das Ansinnen, sich solchen Vorbildern liebend anzugleichen – zumindest, bin ich überzeugt, haben es die Alten so erlebt –, so sein zu wollen wie sie, mag selbst zu heutigem Lebensglück noch beitragen können und bei der wesentlichen Lebensaufgabe helfen, der zu werden, der jemand sein kann.
Die erste Statue eines Gottes, von der Abbildungen (Abbildung) beigefügt sind, darf nach meinem Geschmack und Urteil als die vollkommen-schönste angesehen werden, weil in ihr dem Hochbild einer griechischen Gottheit in der Hoch-Zeit der klassischen Kunst vollendete Wirklichkeit verschafft wurde. Gleichwohl hat auch sie letzten Endes der Rühmung des Menschen gedient und ist als eine begeisternde Gestaltung menschlicher Wünschbarkeiten zu betrachten. Bewusst vage habe ich von „Gottheit” gesprochen, da die Kunstgeschichtler bislang anscheinend keine Einigkeit darüber erzielen konnten, wer gemeint war: Zeus oder Poseidon. Denn was als beigegebenes Attribut darüber womöglich hätte sicherer entscheiden lassen, Blitzstrahl oder Dreizack, ist bedauerlicherweise verloren gegangen. Doch Poseidon, um den es sich meiner Meinung nach wohl doch handelt, ist glücklicherweise in älterer Zeit ebenfalls ein Blitzgott gewesen, vielleicht sogar ein Vorgänger des Himmelsgottes Zeus und auch „patér“ genannt worden wie dieser. Und im Übrigen ist eine ausgewiesene Antwort auf solche Identifizierungsfragen für meine Art Deutung an sich gleichgültig, denn mir soll die Figur ja allein als hervorragendes Beispiel einer Versinnbildlichung des Geist-Charakters der griechischen Götter dienen, mithin hier der Zeus-Wesenheit seit ihrer ursprünglichen Konzeption bei Homer. Nahegelegt worden ist meine Wahl allerdings auch noch dadurch, dass diese Statue die wohl besterhaltene Bronze-Großplastik eines Gottes vom Typ „Bärtige Gottheit im besten Mannesalter“ ist und aus der Zeit der Scheitelhöhe der Klassik um 460 stammt – unglücklicherweise sind die Marmor-Statuen der Hochklassik fast durchweg nur als Torsi erhalten oder, wie andere bronzene, häufig nur in Gestalt späterer römischer Kopien.
Ihren vorzüglichen Erhaltungszustand verdankt die Bronze ihrem Fundort im Meer vor dem Kap Artemision im Norden Euböas, sie misst 2.09 m – das mag auf die gewollt gesteigerte Größe einer Gottheit hinweisen, vielleicht aber auch nur darauf, dass sie als Weihestatue gedient hat, als eine Art Denkmal in freier Natur, und nicht als Kultbild in einem Tempel gestanden hat. Da nun bekannt ist, dass im Jahre 480, nach einem ersten Zusammentreffen der griechischen und persischen Flotte vor Euböa, kurz vor der entscheidenden See-Schlacht bei Salamis, ein plötzlich aufgekommener Sturm die persische Flotte stark dezimiert hat, während sich die ortskundigen Griechen besser in Sicherheit hatten bringen können, und hernach von ihnen Poseidon fromm als Sotér, als Retter aus höchster Not, verehrt worden ist, schließe ich mich bereitwillig der Meinung an, die Statue sei am Kap Artemision als Dankes-Mal für den Herrn des Meeres aufgestellt gewesen und in späterer Zeit von der Steilküste ins Meer hinab gestürzt – wiedergefunden worden ist sie dort erst in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Ich fasse sie folglich als Darstellung Poseidons auf, aber vor allem als die wohl großartigste Verherrlichung des welthistorischen See-Sieges über die Perser, die der bildenden Kunst verdankt wird, würdig im Rang neben Aischylos’ dichterischer Rühmung in dessen „Persern“ gestellt zu werden. Dadurch, dass meine Entscheidung zugunsten Poseidons ausgefallen ist, habe ich mir zugleich die Möglichkeit verschafft, den, wie ich behauptet habe, von Homer eingeleiteten Vergeistigungsprozess der griechischen Gottheiten an einem nicht-literarischen Kunstwerk noch weiter zu verdeutlichen, jedoch nicht nochmals an Zeus, was, wie bereits angedeutet, bereits mit Homer geschehen war und, wie später auszuführen, bei der Deutung von Aischylos erneut aufgenommen werden kann.
Vor der Schilderung der Poseidon-Figur, d. h. nach meinem Verständnis des verklärt menschlichen Geistes in einer seiner schönsten Verkörperungen in der Artemision-Bronze, erlaube ich mir, zur Vorbereitung und zum Zwecke einer gewissen Absicherung meiner Deutung, zwei kleine Hinweise. Den ersten entnehme ich Heraklit, dessen Blütezeit ungefähr ein halbes Jahrhundert früher anzusetzen ist, und der seinen Landsleuten boshaft ins Stammbuch geschrieben hatte: „Sie beten zu den Götterbildern, wie wenn einer mit Gebärden sich unterhalten wollte“ (vgl. fr. 5; Kranz). Als daher zweitens der wohl stark von Heraklit beeinflusste Aischylos seinen „Gott” (Perser; 454) – der Chor nennt ihn „Zeus” (vgl. 532), die Perser lieber „Dämon“ (vgl. beispielsweise 345, 472, 515, 724) –, anders als Homer, zum Herrn des Schicksals (vgl. 101) erhöht hat, der die Hybris einer Landmacht (vgl. 103, 790 ff., 553), die frevelhaft auch noch die Herrschaft über das Meer an sich reißen wollte, fürchterlich bestrafte und den Griechen mit ihrem Sieg (vgl. 455) die Herrschaft über die Ägäis schenkte, dürfte er sich diesen höchsten Gott (vgl. 532) schwerlich noch homerisch-menschengestaltig vorgestellt haben, und der mit Aischylos ungefähr gleichzeitige Schöpfer der Statue mag dergleichen wohl auch kaum noch im Sinn gehabt haben. Ich unterstelle daher dem mit Namen unbekannten Künstler lieber – selbstverständlich neben einem Gefühl patriotischer Dankbarkeit gegenüber einem wohlgesonnenen Schicksal und der unvermeidlichen Anerkenntnis übermenschlicher Naturmächte – als bewusste Motive bei Schaffung eines solchen Kunstwerks: die leidenschaftliche Lust des griechischen Künstlers an der Schönheit; die Begeisterung, die zu jeder schöpferischen Tätigkeit gehört; ein „Ja“ zum großen Menschen; und, vielleicht noch darüber hinaus, als wohlwollendes Geschenk an seine Landsleute: Das Ansinnen, sich nach Maßgabe der vollkommenen Gottheit menschlich zu vervollkommnen. Wenn daher Aischylos die Gräuel-Propaganda vom ruchlosen Xerxes, der den Bosporus in Ketten gelegt habe (vgl. 72, 745), um selbst den Meeresgott sich zu unterwerfen (750), in sein Stück aufgenommen hat – auf solch eindrucksvolles, unvergessliches Bild kann ein Künstler nicht wohl verzichten, der die Botschaft von der Bestrafung der Hybris (vgl. 309, 320; vgl. Herodot; 7.129) seinem Publikum wirkungsvoll verpassen wollte, wogegen ein aufgeklärter Ahura-Mazda-Glaubender, wie es der persische König mutmaßlich gewesen ist, solch ein törichtes und abergläubisches Spektakel in Wahrheit wohl kaum veranstaltet haben dürfte, es sei denn seinerseits zu Propagandazwecken –, so mag des Dichters noch ungebrochene Freiheits- und Patriotismus-Begeisterung die ruhmreiche Abwehr der Versklavung durch den Großkönig zwar als gottgewollt und gottgewirkt angesehen haben, doch hat das bei ihm bestimmt nicht mehr den Glauben an einen anthropomorphen Gott wie den vom Kap Artemision eingeschlossen. Der Zeus dieser Zeit, die einzige Gottheit, die überhaupt in aufgeklärten Kreisen noch übrig geblieben war, dürfte damals bereits weit über Homer hinaus in eine Art geistiges, nicht länger anthropomorph vorgestelltes Prinzip verwandelt, sagen wir verkürzt, zum Garanten einer sittlichen Weltordnung umfunktioniert worden sein. Doch keineswegs hat der tiefsinnige Aischylos darüber der Tatsachen unendlichen menschlichen Leidens vergessen und sich etwa aus dem damit gegebenen Theodizee-Problem herausgemogelt. Und dank Homers vorgegebenem bewundernswertem Humanismus hat er es sogar fertig gebracht, in seinem zwar patriotischen, aber keineswegs chauvinistischen Stück fast ausschließlich des Leids der Feinde und Besiegten zu gedenken und es zu ehren und zu würdigen.
Prinzipiell geurteilt, haben sich die griechischen Götter meiner Ansicht nach von ihrer zwar liebenswürdigen, aber auch etwas despektierlichen Vermenschlichung durch Homer nie mehr erholt, der Aufstieg zu einer Art moralischem Monotheismus wie wohl auch bei Aischylos war daher fast unvermeidlich. Doch ungerührt betrachtet, hatte es der Mensch damit endlich geschafft, selbst die Gottheit nur noch erfolgreicher seiner barbarischen Selbstsucht zu unterwerfen. Und später hat er sich dann von ihr gar einen ewigen Lohn für seinen frommen Glauben und erbärmlichen Gehorsam auszahlen lassen oder sie gar wie im berühmten Fall eines Präsidenten aus unseren Tagen als Retter aus der Trunksucht missbraucht: Jesus loves you more than you will know – doch derart zum Gemächte feigsten Egoismus’ und maßloser Selbstüberschätzung verkommen, kann die Fiktion der Geist-Gottheit vom Kap Artemision wohl doch niemanden anmuten. Gleichwohl vermag man meiner Überzeugung nach diesem Kunstwerk gerecht zu werden nur noch, wenn es nicht mehr so sehr als Hochbild eines Gottes, sondern als Hochbild des griechischen Menschen gedeutet oder die Gottheit vorzugsweise als Vorbild für den Menschen betrachtet wird.
Unterdes will es mir doch nützlich erscheinen, ehe ich in dieser Hinsicht dem Bildnis genauere Betrachtung und Deutung widme, zuvor einen kurzen Blick auf Rang und Charakter Poseidons bei Homer zu werfen und auch auf die mythischen Geschichten, die sich die Griechen ansonsten von diesem Gott erzählt haben, schon um hernach besser beurteilen zu können, was davon in der Gestaltung des unbekannten Künstlers des 5. Jahrhunderts übrig geblieben sein mag, allein noch übrig bleiben konnte – die abgründige Tiefe von Gott- wie Menschenbild in der etwa gleichzeitigen attischen Tragödie hat die bildende Kunst, in Sonderheit die Bildhauer-Kunst, mit den ihr eigenen Mitteln schlechterdings nicht mehr darstellerisch zu erreichen vermocht.
Name wie Herkunft Poseidons scheinen nach wie vor ungeklärt. Die Deutung des vorderen Bestandteils des Namens – „potei“ = „posei“ = „Herr“ – dürfte laut Burkert, dem ich mich in all diesen religionsgeschichtlichen Fragen vertrauensvoll angeschlossen habe, gleichwohl einigermaßen gesichert sein. Dass „da“ = „ga“ = „ge/gaia“ in der Übersetzung mit „Erde“ gleichbedeutend sein könne – Dameter = Demeter, mit der Poseidon vom Mythos in der Tat zusammengebracht wurde, also: Poseidon (Posidaon) = Gatte der Erde – hält Burkert dagegen für gänzlich unbeweisbar (vgl. Griechische Religion, S. 214 f.). Auf den Linear-B-Täfelchen tauchte der Name als „po-se-da-o“ auf (vgl. Kleiner Pauly, S. 1076), was zumindest darauf schließen ließe, dass ein Gott dieses Namens schon den Mykenern bekannt gewesen ist. Sollten diese ihn bereits aus ihrer nördlichen Heimat mitgebracht haben, als einen älteren Allgott wie später Zeus – Homer nennt Zeus aus erkennbaren Gründen seiner eigenen Rangschätzung den ältesten Sohn des Kronos (vgl. Il. 15.182), bei Hesiod wird er wohl authentischer als der jüngere gezählt (vgl. Theogonie; 456) –, so könnte die Verbindung mit der Erdmutter im Mythos auf deren Unterwerfung durch den männlichen Himmelsgott hindeuten. Auch Poseidon sind ja nicht anders als Zeus zahllose Weibergeschichten angehängt worden, die sich am naheliegendsten als die erkämpfte Unterordnung der chthonisch-weiblichen Gottheiten unter den phallischen Zeuger- und Befruchtergott erklären ließen. Dafür spricht auch, dass Poseidon – wie ebenfalls Zeus – die mächtigste Zeugungsgestalt der Alten, der Stier, bis zur Identifizierung zugeordnet worden ist, ehe dieser im Falle Poseidons dann durch das Pferd ersetzt wurde, das spezifisch poseidonische Tier. In Gestalt eines Hengstes soll er auch Demeter bezwungen haben, die sich vergeblich seinem Ungestüm durch Verwandlung in eine Stute zu entziehen versucht hatte – zu Anfang wohl seine Hauptgattin, in der späteren Meeresgott-Karriere durch die Herrin der Meere, Amphitrite, ersetzt. Der Kult des „Poseidon Hippios“, des „Pferde-Poseidon“, ist anscheinend in ganz Griechenland verbreitet gewesen, in Sonderheit auf der Peloponnes – man erinnere sich der isthmischen Wagenrennwettkämpfe zu Ehren Poseidons: „Zum Kampf der Wagen und Gesänge …“. Ohne Umstände hat der Mythos ihn dann zum Erschaffer des Pferdes erklärt: Im Wettstreit mit Athene, die Attika im Falle ihres Sieges den Ölbaum zu schenken versprach, habe er mit einem Schlag seines Dreizacks aus dem felsigen Boden das erste Pferd hervorgezaubert – aber Athene triumphierte dennoch, weil sie zu dessen Nutzung durch den Menschen sinnvoll Zaumzeug und Wagen sowie Zügel erfunden und beigesteuert habe (vgl. Burkert, S. 219, 222) 17 – der unterlegene Poseidon ist eben nur zum halben Geistolympier geworden. Sollte er tatsächlich aus den Steppengebieten Asiens stammen, den Ländern der ersten Pferdezüchter und Streitwagenkämpfer, und von diesen als ihr Hauptgott in die Balkanländer mitgebracht worden sein, so dürfte die Weite der Steppe mit dem wogenden Gras ihn gut nachvollziehbar später zum Meeresgott prädestiniert haben – der ferne Horizont vermochte Neugier und wagemutige Abenteuerlust des Seefahrers genauso herauszufordern wie die endlos weite Steppe die des Nomaden, und die weißgeschäumten Wogen mögen an die flatternden Mähnen der heimatlichen Rosse erinnert haben.
Jedenfalls hat Poseidon seit Homer als großer Gott des Meeres gegolten, sogar überhaupt aller Gewässer, auch der Quellen, Flüsse und Seen. Mythologisch scheint er stärker als die olympischen Geistgötter Tierformen verbunden gewesen zu sein, auch den menschenfeindlichen Elementargewalten: Mit seinem Dreizack, der also vielleicht ursprünglich eine Blitz-Waffe war oder diese ersetzt hat, konnte er Meeresstürme und Erdbeben heraufbeschwören – doch ein weiteres Mal: Poseidon mochte der Herr über Wind und Wellen sein, das erste Schiff hat schließlich Athene den Menschen gebaut. In der Odyssee ist Poseidon dann die Rolle des unerbittlichen Widerparts des seefahrenden Odysseus zugefallen, doch gegen den fürsorglichen Willen der anderen Götter, also Zeus’ und Athenes, vermochte er ihn letztendlich doch nicht an seiner Heimkehr zu verhindern. Genauso wenig ist ihm ein persönlicher Triumph über Troia gelungen, obwohl er sich mächtig gegen die Stadt ins Zeug gelegt hat, weil ihm seiner Meinung nach dort nicht gebührend Ehre erwiesen wurde, der er doch die unüberwindlichen Stadtmauern gebaut hatte. Überhaupt bezeugt er sich in der „Ilias“, wann immer es um sein Ansehen geht, als etwas heikel, wirkt ständig besorgt um seine Reputation und die gehörige Achtung von Seiten der jüngeren Mitgötter, mit deren zunehmend vornehmerem Geistcharakter er nicht recht hatte Schritt halten können. Vor seinem Bruder Zeus muss er knurrend und murrend kuschen, und vom hehren Apollon erfährt er eine missliche, wenn auch klug und nobel verpasste Zurechtweisung. Verstohlen hatte sich Zeus längst auf den Zweikampf der beiden vor Troia gefreut und Poseidon sich dazu auch bereit erklärt, weil er sich um seinen Ruf besorgt zeigte und die Schande fürchtete, als Feigling zu gelten. Aber dann wollte er doch nicht als Erster loslegen, da er sich damit unziemlich (vgl. Il. 21.436) etwas vergeben würde: „Fange doch an; du bist ja der jüngere, denn für mich selber / Will es nicht passen, weil älter ich bin und reicher an Wissen” (Il. 21.439). Doch der Anax, der Herrscher Apollon, weiß natürlich besser, was sich für Götter gehört und was nicht und lehnt kühl ab:
„Erderschütterer, du möchtest mich nicht vernünftig mehr nennen,
Wollt’ ich mit dir um der Sterblichen willen im Kampfe mich messen,
Die so jämmerlich nur, dem Laub der Bäume vergleichbar,
Bald in blühender Kraft die Früchte der Erde genießen,
Bald aber wieder entseelt verschwinden. So laß uns in Eile
Lieber beenden den Kampf; sie sollen ihn selbst nur entscheiden“ (Il. 21.462 ff.).
Denn er scheute sich, hat Homer gutmütig hinzugefügt, „gegen des Vaters Bruder die Hand im Kampf zu erheben” (Il. 21.469) – im Übrigen hätte der alte Dreizackschwinger gegen den fernhin treffenden Bogenschützen wohl einen schweren Stand gehabt. Der Dreizack, bei Homer Poseidons übliches Attribut, dürfte wohl auf ihn als Beherrscher und Besitzer von Meer und Fischen hinweisen, den besonders Seefahrer und Fischer Grund zu fürchten wie zu verehren hatten: Erstere wegen seiner wilden Gewalt über Fluten und Stürme, die er mit dem Dreizack aufwühlte (vgl. exemplarisch: Od. 5. 282–381), wogegen er den Fischern mit der Dreizack-Harpune reiche Beute bescherte, zumal beim Thunfischfang (vgl. Burkert, S. 216).
Wegen dieser engen und kaum auflösbaren Verbindung mit den wilden Elementargewalten von Meer und Erde hat ihn Homer denn auch merklich hinter den hochgeistigen Olympiern zurücktreten lassen: Zum Fürchten zürnt er und tobt dann wild und ungestüm herum, und ist unberechenbar, unkontrollierbar und unhintertreibbar eine schreckliche, unbezähmbare Naturmacht und erschien daher zur verklärenden, vergöttlichenden Personifizierung der geistig-kulturellen menschlichen Fähigkeiten evidentermaßen weniger geeignet. Gleichwohl hat ihm der noble Homer eine prächtige Epiphanie in glanzvoller Macht und Herrlichkeit gegönnt, woran in der bildenden Kunst sehr wohl angeknüpft werden konnte: Vom nahen Samos aus erblickt der Gott, voller Zorn auf Zeus, dem er sich aber zuletzt, zwar murrend, doch wieder fügen muss, die Achäer vor Troia in höchster Not und eilt ihnen – fabelhaft anzuschauen – zu Hilfe:
„Plötzlich stieg er herab vom zerklüfteten Gipfel des Berges,
Reißenden Schrittes voran, da erbebten die Höhen und Wälder
Unter den unvergänglichen Füßen des Gottes Poseidon.
Dreimal schritt er nur aus und das viertemal stand er am Ziele:
Aigai, wo ein berühmter Palast in den Tiefen des Sundes,
Funkelnd von Gold, errichtet ihm war, zu ewiger Dauer.
Angelangt, schirrt’ er ins Joch zwei Rosse mit ehernen Hufen,
Stürmende Renner, die Schultern umwallt von goldenen Mähnen,
Hüllte sich selbst in Gold und faßte die schimmernde Geißel,
Schön geflochten aus Gold, und trat in den Sessel des Wagens,
Lenkte dann über die Fluten, und als er sich nahte, da sprangen
Überall her aus den Klüften die Tiere, den Herrscher erkennend;
Freudig trat auseinander das Meer, und die fliegenden Rosse
Trugen ihn, ohne daß unten die eherne Achse genetzt ward,
Rasch zu den Schiffen der Danaer fort mit sicheren Sprüngen” (Il.13.17 ff).
Daher ist denn auch der erste und stärkste Eindruck, meine ich, den man beim Anblick des Artemision-Poseidon haben mag, der von einer unwiderstehlichen, siegesgewissen Machtgestalt, allerdings nicht mehr aufgrund eines Eindrucks von elementarer Gewalt wie noch im Mythos, sondern von überlegener Geisteskraft in Menschengestalt, von Willensstärke und einem geist-beherrschten Körper in vollendeter Schönheit.
Von solcher, der Statue angeschaffenen Geisteskraft, weltenweit entfernt von aller blinden Naturgewalt, von einem Geistwesen, das der Künstler freilich rein natürlich, körperhaft, zu vergegenwärtigen hatte, zeugt authentisch bereits die frei-aufrecht stehende Haltung des menschengestaltigen Gottes – wie erdverbunden, ja erdverwachsen wirken dagegen noch beispielsweise ägyptische Statuen. An sich schon darf menschliches Aufrecht-Stehen und Aufrecht-Gehen mit hoch erhobenem Haupt als ein sprechendstes Zeugnis für den aufstrebenden, die Erdenschwere zu überwinden trachtenden, freien Geist des Menschen genommen werden, von Homer noch gesteigert und verklärt mit den auf Bergeshöhen leichtlebenden, „ambrosischen” Leibern seiner Olympier. Und überdies ist solch aufrechte Haltung – das Haupt oben, frei blickend, nicht wie das Tier den Kopf animalisch zur Erde gebeugt – ohne Frage das Ergebnis anstrengender Dauerleistung des Willens, mühsam gelernt, schließlich automatisiert, bei nachlassender Spannung sackt der Körper sofort in sich zusammen; zum Schlaf, ohne die Mühe von Wachbewusstsein und Willensanstrengung, legt man sich nieder und sammelt neue Kräfte, um erfrischt und gestärkt sich wieder zu erheben und aufzurichten; der im Krieg Getötete wird als „gefallen“ bezeichnet, ohnmächtig sinkt der nicht mehr geistgehaltene Körper zu Boden: Die Darstellung der dank Bewusstsein und Willen zu Stand und Gang aufrecht gehaltenen Menschengestalt darf daher als eine wesentliche Errungenschaft griechischen Kunstwillens zum Ausdruck der Befreiung zu Tat und Werk gesehen werden, die in dieser Vollendung wohl niemals übertroffen worden ist.
Das Nächste, was ins Auge fällt, dürfte sein, dass der Körper des Gottes bis in die letzte Faser hinein auf einen Zweck ausgerichtet ist, und Zwecke zu setzen ist nun einmal die Domäne des Geistes. Ursprünglich bedeutete das Wort „die Zwecke” den anzuvisierenden und zu treffenden Mittelpunkt einer Zielscheibe. Dank solchen Vorauswissens erschließt sich unmittelbar die Gesamtbewegung des im Metallguss erstarrten, von Meisterhand geschaffenen, göttlichen Körpers: Die Ausrichtung des Kopfes geradewegs hin auf einen imaginären Gegner, diesen aller Wahrscheinlichkeit nach mit festem Blick fixierend aus den verloren gegangenen Augen, gefertigt aus einstmals farbigem Material; die weit ausladende Wurfhaltung beider Arme: vollkommen Geste gewordener Ausdruck der Absicht, mit der Rechten die vernichtende Waffe zu schleudern und mit vorgestreckter Linker richtunggebend das Ziel genau und tödlich ins Visier zu nehmen – man rufe sich Homers Schilderung des erbarmungslos gezielten Speers in die Blöße des Gegners ins Gedächtnis, da Achill den edlen Hektor fällte (vgl. Il. 22.321 ff.).
Und die beabsichtigte Wurfbewegung ist stimmig bis in die Beinstellung hinunter fortgeführt: Der linke Fuß bleibt standfest mit fast ganzer Sohle auf dem Boden aufgestellt, die gesamte Haltung wirkt elastisch ausbalanciert; der rechte Fuß ist nur noch leicht auf den Zehen aufgestützt, im nächsten Augenblick würde er sich vom Boden lösen und nach vorne stoßen, um den Schwung des Wurfes zu verstärken – „würde“, ist zu sagen, denn der Bronzeguss hat alle vorherige und nachfolgende Bewegung im letzten Augenblick vor dem Abwurf für immer erstarren lassen, doch vermochte auf diese Weise von Meisterhand dem überdauernde Gestalt verliehen zu werden, was griechischer Wertung allemal als das Höchste gegolten hat: reine Gegenwart; der erfüllte, sozusagen ewig gewordene Augenblick; die Bejahung machtvoller Lebendigkeit in Form eines herrlichen, aber geistbeherrschten Naturkörpers, der vollkommenen, göttlich schönen Gestalt des menschlichen Leibes.
Unverkennbar ist im Übrigen kein ephebischer Jüngling dargestellt, wie im Falle etwa der traditionellen Apollo-Skulpturen, sondern der vollbärtige Zeustyp, sozusagen ein Mann in den besten Jahren: muskulös, kein Gramm Fleisch und Fett zu viel; ein durchtrainierter Athletenkörper; ein makelloser, eben göttlicher Leib; eine in sich gesammelte Figur, aber versammelt zu Aus- und Angriff. In die angehaltene Aktion achtsamer Konzentration auf den Kairos der Attacke wird daher unweigerlich die Absicht hineingesehen, im bevorstehenden Kampf den Gegner tödlich zu treffen, der angespannte Körper, die gesamte Bewegungsfigur in all ihren stimmigen Einzelheiten bildet eine einzige, unwiderstehliche, übermächtige Waffe, der Dreizack ist davon nur die todbringende Spitze.
Resümiert möchte ich das so verstehen, dass dank eines solchen Kunstwerks gesehen, zumindest gesehen habend gewusst werden kann, dass einem athletisch mächtigen Körper mit derartiger Konzentration auf ein ins Auge gefasstes Ziel und solch offensichtlicher Geschicklichkeit in der Handhabung der Waffe kein Gegner gewachsen sein könnte, der seinem Feind nicht mit derselben geistig disziplinierten, todsicheren Sieg verleihenden Überlegenheit entgegenträte wie sie hier von dem Gott im Triumphbild über alle wild wütende, blind anstürmende „barbarische“ Raserei demonstriert wird, und wie sie sich die Sieger von Marathon und Salamis zu Recht und zu ewigem Ruhm zubilligen durften. Dabei wirkt das Gesicht der Gottheit völlig entspannt, unbewegt, von Verzerrung, Entstellung durch irgendwelche Leidenschaften, durch Zorn, Rachsüchtigkeit, Furchtsamkeit oder auch schonungsbereiter Milde ist nichts darin zu entdecken; die fest aufeinander gepressten Lippen verraten Entschlossenheit, Unerbittlichkeit, todbringende, unbeteiligt-unpersönliche Schicksalhaftigkeit, Unabwendbarkeit.
Sollte aber solch göttliche Überlegenheit geistiger Macht sinnfällig veranschaulicht werden, so hatte der antike Künstler in voller Übereinstimmung mit wohl jedem Einzelnen seiner Landsleute, die allesamt die Schönheit der Gestalt angebetet haben, keine andere Wahl, als die erträumte Vollkommenheit der männlichen Geist-Gottheit in herrlich-nackter Leibhaftigkeit zu bilden. Nur so konnte der Geistadel des Menschen in Verklärungsform zu sinnlicher Darstellung gebracht werden, alles Animalische in der reinen Gestalt überwunden, aufgehoben werden. Selbst das nackte männliche Glied ist maßvoll gebildet, die Schambehaarung kunstvoll geschönt, von einer omnipotenten phallischen Gottheit und ihrer mythischen, wild-vergewaltigenden Zeugungskraft ist hier keinerlei Spur mehr zu sehen, alle Übergewalt des Gottes eignet ihm nurmehr aufgrund der Macht des Geistes. Wie passioniert aber in der griechischen klassischen Kunst die Schönheit der geistbestimmten Gestalt betont worden ist, das lässt sich – außer selbstredend an der Felsenmäßigkeit des starken Gliederbaus, der zwar anatomisch genau, aber maßvoll harmonisch ausgebildeten Muskulatur und dem stillen Ernst des Antlitzes – im speziellen Fall zumal am phantastisch gestylten Bart- und Haarwuchs ablesen: dem prächtigen Vollbart, den in die Stirn fallenden Locken und der geradezu abenteuerlich verspielten Schmuckfrisur mit den am Hinterkopf zierlich geflochtenen zwei Zöpfen, die, nach vorne gezogen, über dem Scheitel zusammengeknüpft sind.
Aber, so darf nachgerade vielleicht auch eine Antwort auf die Frage nach der möglichen Wirkung solcher keineswegs durchschnittlichen oder gar gemeinen, sondern typisierend erhöhten, verklärten, vergöttlichten Menschen-Gestaltung riskiert werden können: Was könnte sich der zeitgenössische damalige Betrachter und Bewunderer der Statue anders gesagt haben als: So gut sehe er selber – beim Zeus! – nicht aus? Leider! Doch gleichwohl würde er liebend gerne auch so aussehen wie der Gott – und mit Haar- und Barttracht könne man ja schon mal anfangen. Etwas ernsthafter gewendet, ließe sich, meine ich, ganz gut nachvollziehen, der sportnarrische Grieche habe sich nach Leibeskräften angestrengt, seinem Körper die gleiche Beherrschung und Geschicklichkeit anzutrainieren, wie sie ihm durch das göttliche Vorbild leuchtend zur Nachahmung empfohlen wurden, d. h. selbstbestimmt zu werden, was der Gott ewig ist – und danach brauchte es eigentlich kein Halten mehr zu geben auf dem Weg zur Selbstvervollkommnung, sie erscheint auf jedem, auch geistigem Niveau möglich.
Daher läge es nahe, meine ich, in die vom Künstler in Bronze gegossene Statue des Gottes hineinzudeuten, wozu, menschlich gesehen, solch geistgeformte Tüchtigkeit des Körpers begeistern könnte. Denn könnte zu Recht angenommen werden, der Artemision-Poseidon sei als Dank- und Gedenk-Mal für die geglaubte Hilfe des Gottes beim Sieg über die persische Übermacht aufgestellt worden, so dürfte sich der damalige Kämpfer und Sieger nahezu unwiderstehlich mit seinem Mut, seiner Tapferkeit, seiner Heimat- und Freiheitsliebe in dem Gottesbildnis wiedergefunden und großartig gefeiert erlebt haben, und enthusiasmiert mögen sich seine Nachfahren zur Nachfolge ihrer Väter aufgerufen gefühlt haben. Überdies könnte die Statue des Gottes ihrem Bewunderer sogar bedeutet haben, was ihr der Künstler an überhöhtem Geistnimbus mit seinen Mitteln gar nicht hatte beigeben können: Dass der Gott der unüberwindliche Beschützer des Vaterlandes sei, zu dem man sich als sein gleichgesinnter Bundesgenosse allerdings erst selbst zu erschaffen hätte, oder, wie Aischylos’ Zeusglauben es sich ausgelegt hat: Die Gottheit sei die machtvolle Gewähr der Gerechtigkeit, von der alle Hybris bestraft worden sei, mit der ein törichter Großkönig sich über die Geistesmächtigkeit Poseidons vermessen erhoben hätte: „Die Götter alle glaubt er voller Unverstand” (Perser; 749). Im Vollbewusstsein seiner gerechten Sache und in berechtigtem Stolz auf die eigene Tapferkeit sowie in Auswirkung des unglaublichen Triumphs über den scheinbar unbesiegbaren Feind mag sich daher im begeisterten Hochgefühl angesichts der Poseidon-Statue unwiderstehlich als Erlebnis von zuversichtlicher Selbstachtung in der eigenen Brust ergeben haben, was Aischylos die persische Königin-Mutter Atossa zu ihrem Leidwesen, aber auch zum ewigen Ruhm der siegreichen Griechen aus dem Munde des Boten hatte hören lassen, der die katastrophale Niederlage ihres Sohnes überlebt hatte: „Wo Männer sind, schirmt eines Walles sichere Wehr” (349).
A p o l l o n
Soll sich dieser von mir angenommenen Botschaft des antiken Griechenlands vom einerseits unüberbrückbaren Abstand zwischen Unsterblichen und Sterblichen, jedoch eines andererseits daraus ableitbaren Vervollkommnungs-Imperativs für den Menschen womöglich noch glaubhafter vergewissert werden, so erscheint dazu keine andere Göttergestalt des Olymps besser geeignet zu sein als ihre herrlichste Vergegenwärtigung im delphischen Apollon – erläutern möchte ich diese Behauptung durch Heranziehung seines wohl berühmtesten, nach meinem Urteil klassisch schönsten Bildwerks aus der Konfiguration des Kampfes von Lapithen und Kentauren vom Westgiebel des Zeustempels in Olympia, geschaffen ebenfalls um das Jahr 460 (Abbildung_1) / (Abbildung_2).
Wie in Poseidons Fall sind Namen und Herkunftsland Apollos unklar; zwar gibt es zahlreiche etymologische Ableitungsversuche des Namens, von denen sich aber anscheinend keine allgemeiner Anerkennung erfreut; auf den Linear-B-Täfelchen ist der Name anscheinend bislang nicht nachzuweisen; in der „Ilias“ gibt Apollon merkwürdigerweise den großen Gegner der Griechen im Lager der Götter ab. Deswegen aber auf einen kleinasiatischen Ursprung zu schließen, bleibt problematisch, den Anklang an das hethitische „Apulunas” hält Burkert für unhaltbar, und die Verfolgung der Spur seines Schwanenwagens zu den nördlichen Hyperboreern verliert sich wohl auch nur in den Nebelreichen der Phantasie. Ich selber halte den Gott ursprünglich, aber ganz und gar unmaßgeblich, für einen Licht- und Sonnengott: In den südlichen Ländern können die Sonnenstrahlen verheerend und tödlich wirken, so wie Homer in der Reminiszenz daran den furchtbaren Bogenschützen zu Beginn der „Ilias“ seine fernhintreffenden Pestpfeile auf das Lager der Griechen hat abschießen lassen: „Und ein schrecklicher Klang entscholl dem silbernen Bogen” (Il. 1.49).
Doch wie dem auch sei, der Mythos Apollos hat sich geistig so überreich entwickelt, dass hier ohnedies davon nur im allergröbsten Umriss berichtet werden kann. In erster Linie begnüge ich mich daher mit der Notierung seines wohl charakteristischsten Wesenzugs, der sich schon bei Homer findet, nämlich der hellen Strahlkraft seiner plastischen Gestalt, die seine finsteren Ursprünge vergessen machte und ihn, wie W. F. Otto konstatiert hat (Die Götter Griechenlands, S. 78) – und Burkert hat dem zugestimmt (vgl. Griechische Religion, S. 225) –, zum „griechischsten aller Götter” werden ließ. Schon von Homer war er als „θεών ώριστος“ bezeichnet worden, als „herrlichster Gott” (Il. 19.413), vielleicht genauer oder sinngemäßer zu übersetzen mit: der jugendschön-ansehnlichste. Denn so fürwahr ist er in der bildenden Kunst rühmend dargestellt worden: als jünglingshaft-schönster und geistmächtigster aller Olympier. Daher wird man sagen dürfen, dass Apollo nicht nur der griechischste Gott gewesen ist, sondern dass er aufgrund seiner unverwüstlichen Jugendlichkeit – zumal auch in Gestalt der zahlreich gefundenen archaischen Kouros-Figuren, bei denen man allerdings nie ganz sicher sein kann, ob sie einen Gott oder einen Menschen meinen – zum Inbild, Hochbild und Vorbild des vornehmen, körperlich und geistig tüchtigen Aristokraten geworden ist, und zwar im authentischen Sinne des Wortes „αρετή“: der Tauglichkeit zum wahren Menschen, Ideal jedes Griechen der alten großen Zeit, Urbild der Kalokagathía, der Schön-Gutheit.
Für diese erstaunliche Karriere Apollos auf griechischem Boden hatte abermals Homer vorgesorgt, der ihn, wie schon gehört, zwar als Parteigänger und Schutzherrn der Troianer geführt hat, aber nicht Anstand genommen hatte, ihn ansonsten über die restlichen Olympier zu erhöhen, mit Ausnahme von Zeus natürlich und allenfalls noch Athene, die aber in der „Ilias“ bei weitem noch nicht so göttlich-distanziert und souverän agiert, wie ihr Gegner auf Seiten der von der Göttin allzu persönlich genommenen Feinde. Dementsprechend hat Homer seinen Apollon durchgängig „άnax“ genannt: „Herr“, „Herrscher“ (erstmals Il. 1.36). Und als sein wesentliches Beiwort wäre „φοίβος“ zu notieren, was so viel heißt wie: „rein“, „klar“, glänzend“, gleichbedeutend mit „hágnos“ = „heilig“. Doch auch dieses Wort muss wieder im Sinne von „rein“ verstanden werden, Wesensbezeichnung ebenfalls für seine Zwillings-Schwester Artemis (vgl. Burkert, S. 405). Vielleicht sind aber diese Benennungen auch bei Homer noch als Reminiszenzen an Apollos Sonnengott- und Artemis’ Mondgöttin-Vergangenheit zu nehmen, anspruchsvoller hat ihn Homer aus dem Munde Achills einmal „Liebling des Zeus” (1.86) genannt.
Weiter oben war bereits seiner, wenn auch ehrerbietig vornehmen, so doch unverkennbar überlegenen Zurückhaltung gegenüber dem allzeit um sein Prestige besorgten Onkel Poseidon gedacht worden, mithin seiner Besonnenheit (vgl. Il. 21.462), wie er sie sich selbst an dieser Stelle attestiert hat, sowie der kühlen Distanzierung des Gottes von den elenden Sterblichen (vgl. Il. 11.463 ff.). Mit gleicher Unnahbarkeit hat er ebenfalls den blutgierigen und sich übermäßig ruhmsüchtig gerierenden Diomedes aus dem wohl später hinzugefügten, extrem todeswütigen fünften Gräuelgesang der „Ilias“ in die Schranken gewiesen:
„Hüte dich, Tydeus’ Sohn, und weiche mir! Wage mitnichten,
Gleich dich den Göttern zu dünken; denn nie sind gleichen Geschlechtes
Selige Götter und Menschen, die wandeln über die Erde!“ (Il. 5. 440 f.).
Ebenfalls hat er machtvoll und unbewegt der wütenden Raserei Achills (vgl. Il. 21.18¸ 21.227; 22.10; 22.312) gewehrt: „Nie doch tötest du mich, denn ich habe kein menschliches Schicksal” (Il. 22.13). Achill reagiert empört (vgl. 22.14), schilt ihn grimmig den „grausamsten unter den Göttern” (Il. 22.15) – doch das ist blindwütige Verunglimpfung der göttlichen Schicksalsmacht, die Apollon repräsentiert und Achill später auch töten wird. Aus solch allzumenschlicher Verblendung durch Hass und Rachsucht wird Achill wieder herausfinden müssen, will er sein höheres Selbst nicht verfehlen, das ihm von Zeus selbst bestätigt worden ist, da er ihn vernünftig, nicht kopflos und gottesfürchtig genannt hatte (vgl. Il. 24.157). Was ihm inzwischen in der bewussten Situation von Apollon abgesprochen wird, er selber dagegen in göttlicher Vollkommenheit besitze, das wird man als etwas festhalten müssen, wodurch das Ethos des homerischen Gottes wie des homerischen Adligen verbindlich gekennzeichnet ist – Achill spricht es ungeniert, aber im speziellen Fall unziemlich, offen aus:
„Jetzt beraubtest du mich des Ruhms und rettetest jene
Leicht, denn du hattest ja nicht die künftige Rache zu fürchten.
Ja, ich rächte mich gern, wenn ich die Macht nur besäße” (Il. 22.17 f.).
Aller Gleichheitsphantastereien und gewohnten Vorstellungen christlicher Moral sollte man sich in Anbetracht Homers gründlich entschlagen. Der Zeus des vierten Gesangs beispielsweise, von dem Agamemnon die Bestrafung der Troianer nach ihrem Eidbruch erwartet (vgl. Il. 4.160 ff.), wird, so er sich deswegen überhaupt rührt, keineswegs aus Gründen von Recht und Gerechtigkeit Vergeltung üben, sondern weil der Eid auf ihn geschworen wurde, mithin bei dessen Brechung sein Name missbraucht und seine Macht, sich dafür zu rächen, missachtet worden ist. An dem Gott, weiß Achill, kann der Mensch sich nicht rächen, denn das wäre sinnlos, weil man ihn nicht töten kann. Und sich an einem Schwächeren zu rächen, wäre ehrlos, unedel und enthüllte allein die eigene Schwäche. Doch unsere Selbstachtung, das weiß auch Nietzsche und wertet so abermals strikt im Geiste Homers, ist daran gebunden, dass wir Unseresgleichen das Gute mit Gutem und Böses mit Bösem vergelten können (vgl. Morgenröthe; 205, S. 182). Und so ist das Erhebenst-Würdigste, Macht zwar zu haben, aber sie nicht zu gebrauchen und sie schon gar nicht zu missbrauchen – Shakespeares Wahrheit aus dem 94. Sonett: „They that have power to hurt and will do none“. Oder seine Einlassung: „O, it is excellent / To have a giant’s strength; but it is tyrannous / To use it like a giant” (Maß für Maß, II. 2; vgl. hierzu v. Verf.: Shakespeare und das neuzeitliche Heidentum, bes. S. 29 f.).
Apollon ist nicht nur der griechischste, sondern außer Zeus auch der geistig machtvollste aller Götter, Zeus fast gleichrangig. Er selber gibt zwar ehrenwert vor, die Gabe der Prophetie – sein delphischer Ruhmestitel – sei ihm von Vater Zeus verliehen worden, doch in Wahrheit ist er genau wie dieser eine wissende, vorbehaltlos den Willen der Moira ausführende Wesenheit. Als Zeus’ Waage das Todeslos Hektors kürt, fügt Homer dem moiraverhängten Schicksal schlicht bei: „Es verließ ihn Phoibos Apollon” (Il. 22.213) – augenblicklich, darf man hinzufügen. Nicht murrend, nicht jammernd, sondern wissend um das Unabänderliche, völlig unpersönlich. Und dabei war der gottesfürchtig-edle Hektor doch Zeus selber und den meisten der übrigen Götter, von Apollo ganz zu schweigen, „der liebste von allen, die Troja bewohnen” (Il. 24.67), gewesen. Daher ist von Homer auch Apollon die schärfste Anklage gegen die unweise Parteiischkeit der Götter in den Mund gelegt worden. Als Achill den Leichnam Hektors schändete, fühlten die Götter Mitleid und verfielen auf den hilflos tollen Plan, Hermes die Leiche stehlen zu lassen. Doch die hasserfüllten, sich in ihrer Ehre gekränkt fühlenden Poseidon, Hera und Athene (vgl. Il. 24.25) versagten dem Plan erbost Zustimmung und Ausführung. Da hat der Anax sie gescholten: „Schrecklich seid ihr doch, Götter, und grausam” (Il. 24.33). Nicht einmal dazu, einem Toten die letzte Ehre der Verbrennung seines Leichnams zu gönnen und zu gewährleisten, seien sie in ihrer parteiisch blinden, mithin nichtswürdigen Liebe für den zum Unhold (vgl. 24.44 f.) gewordenen Achill im Stande. Daher taugten sie nichts, weil sie keine Achtung verdienten.
Dagegen hat der „Anax Apollon“, zumal dank seiner nachhomerischen Entwicklung, wahrlich die volle Achtung und Ehrerbietung seitens der Menschen verdient, nämlich als Inbegriff dessen, was Nietzsche als das Apollinische bezeichnet hat: Souveränität des klarsehenden, reinen Geistes; vornehme Distanziertheit; Musterbild von Maß und Ordnung; Musagetes, Gönner und Förderer von Kunst und Wissenschaft. Mithin Inbegriff all dessen, was den delphischen Apoll dazu befähigt hat, selbst seinen wildesten Widerpart, Dionysos, einigermaßen zu zähmen – am bewundernswertesten wohl mit der attischen Tragödie geglückt, weswegen ich das Dionysisch-Göttliche erst bei deren Deutung behandeln möchte, sozusagen mit dem angeborenen, griechisch-apollinischen Auge gesehen und von Apollo aus gewertet.
Das Apollinische, bin ich überzeugt, bildet aber nicht allein das Wesen der olympischen Götter, in Sonderheit Apollos, sondern darf als Quell aller besonnen-griechischen Diesseits- und Daseinsbejahung angesehen werden, wie sie erstmals bei Homer greifbar wurde. Denn wenn in Apollo, wie ich ihn entmythisiert verstehen möchte, eine Wünschbarkeit menschlicher Vernünftigkeit essenziell vergöttlicht worden ist: Was hätte die Menschen danach daran hindern sollen, sich als Ebenbild der verehrten Gottheit anzusehen und mit Leib und Seele danach zu trachten, diesem Vernunft-Ideal in Wahl und Wille zur Selbstvervollkommnung nach Kräften Verwirklichung zu verschaffen? Dass ich mich mit solcher Ansicht vom Verhältnis und von der Wertung von Gott und Mensch – die dem aristokratisch fühlenden Menschen wie auf den Leib geschrieben erscheinen kann – in bester Gesellschaft befände, mögen ein, zwei Verse vom größten Ruhmredner griechischen Adels und des von diesem adoptierten Hauptgottes Apollon bekräftigen, also Pindars. Von der unüberbrückbaren Kluft zwischen Göttern und Menschen weiß dieser nicht anders als Apoll oder auch Homer zu antworten, wenn er sich fragt: Was ist der Mensch: „Der Schatten Traum, sind Menschen“, heißt es bei ihm. Doch bezeichnend griechisch hat er diese Aussage fortgesetzt: „Aber wenn der Glanz, / Der gottgegebene, kommt, / Leuchtend Licht ist bei den Männern / Und liebliches Leben“ (Pyth. 8; zit. Hölderlin: Bd. 5, S. 111 f.). Ich deute: Wenn der Mensch dem hehren Vorbild Apollos nachzufolgen bestrebt ist, seinem Geistwesen Wirklichkeit verleiht, dann mag ihm ein menschenwürdiges „Ja“ zum Leben gelingen, trotz dessen Hinfälligkeit, trotz Leid und Tod. Daher die berühmte Forderung des Gottes lautet, Aufschrift in seinem Tempel zu Delphi: „Γνώθι σεαυτόν“: „Erkenne dich selbst“! Erkenne, wer der Mensch wahrhaft ist! Wisse um seine Sterblichkeit und also auch um die deinige! Daher denn auch Pindars ethische Schlussfolgerung aus dem Weisheitsspruch des Gottes geheißen hat: „Werde, der du bist, erkennend” (Pyth. 2)! Trachte nach Erkenntnis deines wahren Selbst, dessen, was Du sein kannst und wirklich sein willst, und dann lebe danach! Und sei dabei stets Apollos Warnung eingedenk: „Es ist aber not, sich selbst gemäß allzeit / Von allem zu sehen das Maß“ (Pyth. 2; zit. Hölderlin, S. 80).
Diese apollinische Botschaft mag in der Folge noch etwas genauer vom marmornen Gott aus Olympia verkündet werden!
Dargestellt ist im Westgiebel des Tempels eine sogenannte Kentauromachie: Ein grimmer Kampf zwischen schöngestaltigen Menschen, den Lapithen, und monströsen Ungeheuern, den Kentauren, halb Mensch, halb Pferd, entbrannt bei Gelegenheit der Vermählung des Lapithenkönigs Peirithoos mit Hippodameia – ich verstehe den Namen als Pferdebändigerin, vielleicht war sie amazonischer Herkunft. Zum Hochzeitsfest hatte der König nebst seinem Blutsbruder, dem athenischen Theseus, mit dem er zahllose Abenteuer bestanden hatte, auch seine unzivilisierten Nachbarn aus den thessalischen Bergen eingeladen. Der ungewohnte Weingenuss beim Fest entfesselte deren tierische Wildheit, ihr Anführer, der Kentaur Eurytion, vergriff sich an der schönen Braut, und seinen Kumpanen gelüstete es genauso begehrlich nach Raub und Vergewaltigung. Es kommt zum Kampf. Die Heroen in der Mitte, beide völlig aufgerichtet, Peirithoos und Theseus, zücken das Schwert und schwingen die Axt, der Sieg des Guten über das Böse dank Sympathie und Fürsorglichkeit der Gottheit, müsste man heutzutage in Ansehung der tagtäglichen, zahllosen Fernseh-Krimis sagen, kann nicht zweifelhaft sein. Mit griechischen Augen betrachtet, bedeutet aber der Gott, das chaotische Getümmel überragend, genau in der Giebelmitte hochaufgerichtet – mit gebieterisch weit ausgestreckter Rechten, völlig unbeeindruckt von Gewalt, Schmerz und Totschlag – vielleicht doch noch etwas anderes, etwas Ursprünglicheres, das über die übliche Deutung von Einhalt-Gebieten und Sieg-Verleihen hinausginge. Denn aus welchem Grund sollte der Gott den Kampf und die tödliche Bestrafung der Frevler anhalten wollen? Apollon war doch kein Pazifist, der Kampf und Krieg verabscheute, nicht einmal unbedingt ein Menschenfreund, allenfalls der Freund derer, die ihm glichen. Und aus welchem Grund hätte der Gott den Kampf denn entscheiden und den Sieg willkürlich verleihen sollen? Jedenfalls greift er überhaupt nicht ein, von keinem der in blindwütigem Streit Verstrickten wird er überhaupt wahrgenommen, zumindest nicht beachtet: Den Sieg über das Unbeherrscht-Ungeschlachte müssen die Menschen schon selbst erringen. Sehen wir zu, ob sich Absicht des Künstlers und Konzeption des Gottes aber womöglich noch genauer erfassen lassen!
Bei Betrachtung und Vergleichung der beiden feindlichen Parteien fällt zunächst ins Auge: Lapithen und Lapithinnen sind durchweg gesittet gekleidet, die Kentauren natürlich nicht – das lässt wohl auf eine Auseinandersetzung zwischen Höher- und Niedriger-Bewertetem schließen, vielleicht also, mit weiterem, zwischen Geist und Natur, so wie ich bereits den Kampf der Olympier mit den Titanen verstanden hatte, und bekanntermaßen ist das ein beliebtes Sujet antiker Künstler gewesen: Kampf der Zivilisierten mit den Barbaren, mit irgendwelchen Unmenschen, beispielsweise auch noch den Amazonen, die selbstverständlich allemal den Herakles, Theseus, Bellerophontes, Achilleus unterlegen waren. In diesem Zusammenhang darf auch nochmals daran erinnert werden, mit welch unverfrorenem Hochmut die Griechen nach gewonnenem Perserkrieg auf alle Nichtgriechen als auf Barbaren heruntergesehen haben, die nur „bar“, „bar“ stammeln, also nicht wie richtige Menschen griechisch sprechen könnten, bis zu böser Letzt Platon und Aristoteles die Barbaren ex cathedra zu „Sklaven von Natur aus” erklärt haben – ungerührt hatte es Aristoteles nach den Regeln der Kunst definiert: Der sei ein Sklave, der sich nicht selbst gehöre; mithin einem anderen gehöre, weil er nämlich vernunftlos sei; mithin der Vernunft eines vernünftigen Menschen, seinem Herrn, unterworfen und ihm zu Diensten sein müsse (vgl. Pol. I. 5). Nach Belieben waren auf diese Weise Frauen und Söhne, wenn man’s nicht gar zu genau nahm, von den Töchtern ganz zu schweigen, und nach Bedarf auch einmal störrische, an sich selbstverständlich „vernünftige“ Griechen, die daher an sich nicht versklavt werden durften, leicht ins Sklavenschicksal mit hineinzudefinieren – Philosophenlogik!
Und diese hinterweltlerischen Bewohner der unwirtlichen thessalischen Bergwelt hat man sich unausweichlich als solch unzivilisierte Gesellen vorzustellen, vom übertreibenden Mythos sind die Kentauren in bloße, roheste Natur zurückverwandelt worden. Ihre tierische Wildheit, Maßlosigkeit, pure Triebhaftigkeit verraten sich prompt, als sie mit einem Göttergeschenk wie dem Wein konfrontiert wurden: Anstatt ihn mäßig, mit Wasser verdünnt zu genießen, wie anständige Griechen und zivilisierte Menschen das tun, besaufen sie sich hemmungslos und enthüllen dadurch ihre bestialische Natur, ihre brutalen Begierden: zu rauben, zu vergewaltigen, zu morden – in den einzelnen Szenen wird das drastisch vorgeführt. Allerdings sind einige Zuordnungen, auch im Falle ganzer Figurengruppen, bei der Wiederaufstellung im Museum anscheinend strittig geblieben. Doch unverkennbar schamlos sieht man die Kentauren nach den entblößten Brüsten der Frauen grapschen; die sich Sträubenden haben sie mit ihren Armen umklammert, suchen sie an den Haaren hochzureißen und auf ihren Rücken zu zerren; atavistisch hat sich einer im Arm seines Gegners verbissen, der ihn zu erwürgen droht; in Restitutionsversuchen ist gar die Schändungsattacke auf einen Lapithen-Knaben zu sehen.
Zu Letzterem mag ich mir eine kurze Abschweifung auf den mythischen Apoll nicht versagen, von der klassischen bildenden Kunst ist ihm allemal nur noch Homers hehre Hochgestalt angebildet worden.
Im alten Mythos war Apoll aber in zahlreiche Liebschaften verwickelt gewesen, mit Mädchen wie mit Knaben, die interessanterweise durchweg kein glückliches Ende gefunden haben. Ich erwähne beispielsweise nur Daphne, die sich seiner aufdringlichen Nachstellung durch Verwandlung in einen Lorbeerbaum entziehen musste; oder Koronis, die Krähenjungfrau, Mutter des Asklepios, die ihn noch vor dessen Geburt mit einem sterblichen Mann betrogen hatte und zur Strafe von der erbosten Schwester Artemis mit ihren Pfeilen getötet wurde; oder die troianische Kassandra, die seine Liebe verschmähte und der er rachsüchtig zwar seine prophetische Gabe geschenkt hat, aber mit dem üblen Geschick verbunden, dass ihre Weissagungen bei niemandem Glauben fänden. Und auch mit seinen Jünglingslieben, mag er auch als Initiator und Patron der gleichgeschlechtlichen Liebe gerühmt worden sein, ist es ihm nicht besser ergangen: Im berühmtesten Fall hat er versehentlich seinen geliebten Hyakinthos im Diskos-Agon getötet – aus seinem auf die Erde geflossenen Blut entsprosste dann die Hyazinthe.
Was mögen diese gehäuften Unglücksfälle, so verschieden von den erfolgreicheren Liebschaften eines Zeus oder Poseidon, wohl bedeuten? Ich weiß es nicht und habe auch nirgends eine Antwort auf diese Frage gefunden, möchte aber doch, weil man’s ja nun mal nicht lassen kann, eine Meinung dazu äußern, die zu unserem Olympia-Apoll zurückführt.
Burkert hat ein homerisches, charakteristisches Beiwort Apollos: „ακήρ σεκόμας“ mit: „Der mit dem ungeschorenen Haar“ (vgl. S. 227) übersetzt, womit auf das noch lang getragene Haar des Epheben angespielt ist, der in die Männergesellschaft erst initiiert werden muss – von der Vergötterung der Jugendlichkeit im Wertesystem der Griechen, im Nichtaltern ihrer Götter an den Himmel geschrieben, war schon öfters die Rede: In Apoll ist dieser schönsten Jugendblüte des Mannes ewige Gestalt verliehen worden, und das bestimmt nicht ohne Beziehung auf den homoerotischen Sex-Appeal. Und unverkennbar hat diese im menschlichen Leben so flüchtige Jugendfrische der griechischen Männer-Kultur ein charakteristisches Gepräge gegeben: Die nur sogenannt platonische Liebe ist – nicht nur in Sparta – die Basis des antik-griechischen Männerlebens gewese, in Muße und Erziehung, in Politik und Krieg – in letzterem Fall erinnere man sich nur an die heilige Schar der Thebaner. Ihre beiden ewig herrlichsten Jünglingsgestalten, der mythische Achill und der historische Alexander, sind beide in jungem Alter verschieden, und passenderweise hat die Blütezeit der griechischen Kultur kaum ein Jahrhundert gedauert – die Früchte hat Rom geerntet. Apollo, so er denn ursprünglich ein Gott des Lichtes und der Sonne gewesen ist, sollte also vielleicht genauer als ein Gott des Frühlichts und der machtvoll aufgehenden Sonne verstanden werden, der Sonne, die dann allem erst Klarheit, Umriss, Gestalt verleiht. Und all diese der Sonne verdankten schönen Gestalten vergehen nicht, sind beständig, solange der Tag dauert – sie sind, wie die Philosophen es später metaphysisch fassen werden. Aber ein noch sittlich ungefestigter Jüngling, gerade erst in die Männergesellschaft aufgenommen, mag sehr wohl, von noch unbeherrschter Sexualität und ohne den pädagogischen Eros des gereiften Mannes, für die noch jüngeren Knaben eine Gefahr gewesen sein, und Päderastie, also Sex mit Knaben vor der Pubertät, ist auch im – der Liebe zwischen Männern ansonsten keineswegs abholden – antiken Griechenland unter strenges Verbot gestellt gewesen. Für den kaum dem Kindesalter entwachsenen Epheben könnten daher die Geschichten über die gescheiterten Knabenlieben des selber noch jugendlichen Gottes als Warnung vor einem ähnlichen üblen Schicksal gedient haben, wie ebenfalls zur Erklärung seiner ungelenken Versuche, sich einer selber noch Jungfräulich-Unberührten begehrlich zu nähern, wie beispielsweise Daphne, gänzlich vom Typ seiner ewig keuschen Schwester Artemis, der „Süßen Wilden“.
Vielleicht haben also vage Reminiszenzen an diese Probleme des ersten Jünglingsalters in die überlieferten Apollo-Mythen hineingespielt, bei unserem marmornen Olympier ist davon aber natürlich nichts mehr übrig geblieben – außer eben der Jünglingsgestalt in prangender Schönheit und im Lockengeriesel seiner atemberaubenden Schmuckfrisur. Sein Leib stellt sich in göttlich vollkommener Nacktheit dar, da ist nichts zu verbergen: aufrecht, fest, stark, von ebenmäßigem Wuchs, hoch emporgehoben, die Muskulatur schwellend, doch keineswegs übertrieben dargestellt – ein erster Eindruck von gelassener Unbezüglichkeit, von Erhabenheit drängt sich dem Betrachter auf. Ein Teil des Gewandes wirkt lässig über die rechte Schulter geworfen, ein anderes um den linken Unterarm geschwungen. Die Rechte ist weit über Kampf und Chaos unter ihm ausgestreckt, der Kopf entschieden in dieselbe Richtung gewendet, so dass er sich dem vor ihn tretenden Betrachter in klassisch griechischem Profil zeigt. Aber trotz dieser auffälligen Gesten von Arm und Kopf wirkt die Figur vollkommen ruhig, still; alle Bewegung ist im Marmor erstarrt; ein Menetekel zeitenthobener Ewigkeit; von Kampf und Tod des sterblichen Menschen gänzlich unberührt; ein Bild unnahbarer Hoheit, kühler Strenge, absolut edler Wohlgestalt; die ungerichtet-blicklosen, aber weit offenen Augen verraten nicht die geringste Spur von neugieriger oder besorgter Anteilnahme am wilden Kampfgetümmel, es ist ein Blick in die Ferne, der Blick des Geistes.
Dieser Gott wird daher nicht als nächstes den Befehl zum Aufhören über die Lippen bringen, auch der ausgestreckte Arm soll keinen Abbruch des Kampfes und Frieden auf Erden bewirken, nicht einmal den Lapithen den Sieg schenken – doch unvermeidlich werden ihn diese selbst erringen, denn sie kämpfen im Geist des Gottes: Ihre edlen Gesichter, auch die der Frauen, wirken noch in größter Bedrängnis völlig beherrscht, in ihrer Schönheit spiegelt sich die seinige wider, ein stärkster Kontrast zu den hässlich-wild verzerrten Gesichtern der Kentauren. Dieser Gott greift nicht ein in das Kampfgeschehen, er braucht gar nicht einzugreifen. Denn der Sieg des apollinischen Geistes über alle wilde Natur, der Sieg der Vernunft über die Triebe, ist göttlich zeitlos immer schon geschehen und gewährleistet, die Entschiedenheit seiner herrschaftlichen Geste und die offenbarte Schönheit seiner Leibesmächtigkeit bezeugen es für immer und ewig. Mit Apollon bekundet sich der Geist als allezeit siegreich in der überwältigend schönen, über allen Wechsel und Wandel triumphierenden Vollkommenheit von Sinn und Maß, und unverbrüchlich wird durch das Sonnen- wie Vernunftlicht Apollos, das Welt und Wirklichkeit ins Helle und Klare bringt, ebenfalls die Wahrheit über die unüberbrückbare Kluft zwischen dem zeitenthoben göttlichen Geist und den sterblich-vergänglichen Menschen enthüllt. Doch zugleich mag sich der Mensch dank des Anblicks des menschengestaltigen Gottes seines eigenen möglichen Sieges über alles Tierisch-Allzumenschliche in ihm versichert fühlen, so er nur, bei voller Erkenntnis und Anerkenntnis seines Endlichkeitswesens, dennoch dem Gott in dessen Geiste willig nachfolgt.
Ob dieser zuletzt metaphysische Glaube der Hellenen nicht ebenfalls als schwere Erblast auf allem nachfolgenden Sinnen und Trachten gelegen hat, das soll als schicksalhaft-gewichtige Frage an die menschliche Geistesgeschichte erst gelegentlich der Auseinandersetzung von Apollo mit Dionysos in Ansehung der attischen Tragödie ausführlich aufgeworfen werden, denn dieser dem Geistgott ebenbürtige Gott der Natur lässt sich bestimmt nicht so leicht und einwandfrei besiegen wie diese Ungeheuer von halbtierischen Kentauren. Der später radikalisierte Angriff auf das irdisch-leibhafte Trieb- und Gefühlsleben des Menschen im Namen der Transzendenz ins Übernatürliche, die Verteufelung und tendenzielle Zerrüttung seiner Natur, die den ihr zukommenden Anteil am menschlichen Leben, wenn dies gedeihen soll, unerbittlich fordert, also die übermäßige Schwächung und Vergewaltigung seiner Natur durch den Geist droht, den Menschen schließlich unheilbar krank zu machen, dekadent, reif zur Abdankung an die Maschinen. Wie sich dagegen ein maßvoller Sieg Apollos über Dionysos vorstellen ließe, wenn die Indienstnahme des Letzteren zur Steigerung des Ersteren nicht auf unterdrückende Versklavung hinausliefe; wenn der Tiger geritten und der Drache nicht getötet, sondern gezähmt an langer Leine geführt würde, davon mag die folgende Rühmung einer wünschbaren Vereinigung von Apollon und Dionysos aus dem Munde Nietzsches etwas ahnen lassen. Und auf diese Weise könnte der notorische Rationalismus der Griechen, das Verhängnis eines überzogenen Apollinismus und ebenfalls Aristokratismus vorab kritisch bereits ein wenig in die Schranken verwiesen werden, ohne dass deswegen der Mut zur Selbstliebe, zu Unabhängigkeit und Auszeichnung, zur Selbstbestimmung preisgegeben werden müsste:
„Das Genie des Herzens, wie es jener grosse Verborgene hat, der Versucher-Gott und geborene Rattenfänger der Gewissen, dessen Stimme bis in die Unterwelt jeder Seele hinabzusteigen weiss, welcher nicht ein Wort sagt, nicht einen Blick blickt, in dem nicht eine Rücksicht und Falte der Lockung läge, zu dessen Meisterschaft es gehört, dass er zu scheinen versteht – und nicht Das, was er ist, sondern was Denen, die ihm folgen, ein Zwang m e h r ist, um sich immer näher an ihn zu drängen, um ihm immer innerlicher und gründlicher zu folgen: – das Genie des Herzens, das alles Laute und Selbstgefällige verstummen macht und horchen lehrt, das die rauhen Seelen glättet und ihnen ein neues Verlangen zu kosten giebt, – still zu liegen wie ein Spiegel, dass sich der tiefe Himmel auf ihnen spiegele – ; das Genie des Herzens, das die tölpische und überrasche Hand zögern und zierlicher greifen lehrt; das den verborgenen und vergessenen Schatz, den Tropfen Güte und süsser Geistigkeit unter trübem dickem Eis erräth und eine Wünschelruthe für jedes Korn Goldes ist, welches lange im Kerker vielen Schlamms und Sandes begraben lag; das Genie des Herzens, von dessen Berührung Jeder reicher fortgeht, nicht begnadet und überrascht, nicht wie von fremdem Gute beglückt und bedrückt, sondern reicher an sich selber, sich neuer als zuvor, aufgebrochen, von einem Thauwinde angeweht und ausgehorcht, unsicherer vielleicht, zärtlicher zerbrechlicher zerbrochener, aber voll Hoffnungen, die noch keinen Namen haben…” (Jenseits von Gut und Böse; 295, S. 237).
A t h e n e
Um die olympische hochheilige Trinität zu vervollständigen, fehlt noch Athene. Als eines ihrer Wesensbildnisse (Abbildung) habe ich ihre Darstellung auf einer Metope ausgewählt, abermals aus dem Zeus-Tempel von Olympia: Herakles bei Atlas. Athene wird dabei als Patronin des größten griechischen Heros vorgestellt, des Zeussohnes Herakles; sie steht ihm nahe wie ihr Vater ihr, und zwischen Gott und Mensch besteht ein rein freundschaftliches, kein Untertanenverhältnis. In gleicher herzlicher Verbundenheit, fast wie von Gleich zu Gleich, hat sie ebenfalls ihre zwei anderen Lieblinge beschützt und beraten, die beiden sich polar ergänzenden Verkörperungen griechischen Wesens: Achill und Odysseus.
Auch hier hat Homer wieder alles Spätere grundgelegt und vorbereitet. In seiner „Odyssee“ bewährt sich Athene als die überlegen alles zum gottgefälligen Ende vollbringende Göttin, der sich selbst der unversöhnliche Poseidon schließlich zu fügen hat, weil sie nämlich mit Willen und im Auftrag von Zeus, d. h. der Moira handelt – man könnte die Odyssee als die Aristie Athenes auffassen. Als weltkluge Mentorin weist sie den noch blutjungen Odysseussohn Telemach auf der Suche nach seinem verschollenen Vater in die große Welt des höfischen Adels bei Nestor und bei Menelaos und Helena ein, aber substantiell wird durch ihr Wesen ihrem Liebling Odysseus sein Lebenserfolg gewährleistet, dem ihr verwandt „Vielklugen“ (πολύμητις; Il. 3.200), „Vielerfindungsreichen (πολυμήχανος; Il. 2.173), „Vielgewandten“ (πολύτροπος; Od. 1.1). Den Adelsbrief seines Athene-Wesens hat sie ihm höchstselbst ausgestellt: „Du … bist”, rühmt sie gleicherweise sich wie ihn, „unter den Sterblichen der weitaus beste … an Rat und Worten, ich aber unter allen Göttern berühmt durch Klugheit (μήτις) … und Listen“ (Od. 13.297 f.). Daher „kann ich dich auch nicht verlassen, wenn du im Unglück bist, weil du verständig bist und geistesschnell und einsichtsvoll” (Od. 13.328 f.).
Um zu abgeklärter Geistwesenheit aufzusteigen, wozu nach den Anfängen bei Homer auch die bildende Kunst ihr Gutteil beigetragen hat, musste allerdings auch diese Göttin einen weiten Weg zurückzulegen. Aus komplexen, verwirrend widersprüchlichen und noch sehr orientalisch anmutenden, dunklen Anfängen, auf die hier unmöglich Bezug genommen werden kann, hat sich erst nach und nach das hehre Bild der Parthenos herausgebildet, der allzeit jungfräulichen Göttin in ihrem Schmuckgemach, dem Parthenon auf der Athener Akropolis: Athene als Archetyp der sophrosýne, der – übersetzen wir – Besonnenheit. Abermals ist der Name ungeklärt, es gibt aber eine Erwähnung auf einem in Knossos gefundenen Linear-B-Täfelchen, wo sie „a-ta-na po-ti-ni-a“ genannt worden ist: „Herrin Atana“. Ich lege mir das so aus, dass sie in minoischer Zeit als Burgherrin, als Schutzgöttin des Palastes verehrt wurde, mit noch ausgesprochen mütterlichen Zügen der Großen Göttin, der die Mauerkrone eignete, Züge, die später, vielleicht schon in mykenischer Zeit, rigoros ausgetilgt worden sind. In den Mythen ist sie mitunter noch „Mutter“ genannt worden. Doch wie sehr man bemüht gewesen ist, solch uralte Vorstellungen von fruchtbarem Geschlecht und einer Jungfrau-Mutter aus ihrem Wesen auszumerzen, geht zur Genüge aus der delikaten Gründungsgeschichte Athens hervor: Hephaistos, mit dem sie auch sonst wegen der beiden gemeinsamen Erfindungsgabe und Kunstfertigkeit in enger Beziehung gesehen wurde, hatte sie sich als tätiger Mithelfer bei ihrer Geburt aus dem Haupte von Vater Zeus sogleich als Braut ausbedungen. Doch als er sich ihr dann in der Hochzeitsnacht näherte, hat sie sich ihm brüsk verweigert, sein Samen fiel auf die Erde, diese wurde davon schwanger und gebar den Erechthonios, den autochthonen Urathener, den die Göttin dann immerhin mütterlich gepflegt und aufgezogen hat.
Vergleichsweise früh bildete sie also den Typ „Virago“ aus: das unverheiratete Mädchen, die leiblich und geistig starke und selbstbewusste Jungfrau, keusche Gefährtin des jungen Mannes, die aber nicht, anders als die spröde Artemis, die Männer vollständig abgelehnt hat, sondern ganz im Gegenteil zur idealen Freundin und Beschützerin der namhaftesten Heroen geworden ist, neben den schon genannten noch von Perseus, Tydeus, Diomedes. Vielleicht ist sie zu solch freundschaftlicher Gehilfin schon in der Männerwelt des mykenischen Kriegeradels verwandelt worden, der nicht mehr in üppigen Palästen, sondern in mauergeschützten, wehrhaften Burgen hauste, und daher mögen in solch kämpferischer Potnia – Schildmaid wie die germanische Walküre, Rossebändigerin und Streitwagenlenkerin – sogar altindogermanische Reminiszenzen aufbewahrt geblieben sein, womöglich angereichert durch Einflüsse orientalischer Kriegsgöttinnen vom Typ Ischtar, Anahit. Laut griechischem Mythos entsprang sie, wie bekannt, dem Haupte ihres Vaters Zeus in schimmernder Waffenrüstung, den Wurfspeer schwingend und mit laut schallendem Kriegsruf. Auch Homer hat sie als kriegsfreudige Göttin geführt, die zum Kampf anspornt, ungeduldig dem Heer voranstürmt, begierig, sich mit Ares zu messen; die treu ihren Lieblingen schützend und helfend zur Seite steht und ihnen Kampfbegier und Tapferkeit einflößt – eine „Göttin der Nähe”, hat W. F. Otto sie deswegen genannt (zit. Burkert, S. 223), in starkem Gegensatz zum distanziert fernen Apollo. Gleichwohl ist auch ihr eigentliches Wesen ihr Geistcharakter gewesen, mag dieser von demjenigen Apollos auch noch deutlich zu unterscheiden sein; ihre überlegen-besonnene Art zu kämpfen, hebt sie jedenfalls wohltuend ab vom blindwütigen Vorwärtsstürmen, von der Mord- und Beutelust des ihr und auch Homer verhassten Halbbruders, des blutrünstigen Ares (vgl. Il. 21.402).
Eine mythologische Genealogie von Athenes Geistwesen wird Hesiod verdankt. Der war ja in seiner Theogonie eifrig darum bemüht gewesen, einem moralischen Zeus und einer vernünftig-gerechten Weltordnung das Wort zu reden. Daher hatte er ihn nacheinander, wie schon früher erwähnt, mit Themis, der Mutter von Eunomia, und danach auch noch mit Dike und Eirene verheiratet sein lassen, um ihn so zum Anwalt von Recht, Gerechtigkeit und Frieden erklären zu können. Seine allererste Gemahlin soll aber Metis gewesen sein, die Klugheit, die ihm kluge Kinder gebären sollte – und so kam denn Athene zur Welt, die „helläugige Tritogeneia, dem Vater gleich an Mut (μένος) und planendem Willen“ (επίφρονα βουλήν; 895 f.). Mochte daher ihr Mut und ihr kriegerisches Wesen von Zeus herrühren, ihre Klugheit hat ihr Hesiod von der Mutter abgeleitet. Da Zeus nun prophezeit worden war, ein Sohn der Metis würde ihn die Herrschaft kosten, hatte er diese, die bereits mit Athene schwanger ging, flugs mitsamt ihrem noch ungeborenen Kind verschlungen, und zur gegebenen Zeit ist dann eine Tochter gewappnet seinem Haupt entsprungen. Ohne Frage hat Athene daher als Vater-Tochter zu gelten, als Zeus’ Kopfgeburt – aber das war nur dadurch zustande gekommen, dass Zeus sich zuvor die Metis einverleibt hatte, die „Weiseste unter Göttern und sterblichen Menschen” (888 f.), damit er wisse, erklärt der moralische Hesiod, „was gut sei und böse“ (899). Und so ist Athene denn auch im homerischen Hymnus gleich zu Beginn, noch ehe sie als Kriegsgöttin gerühmt wird, die „Polýmetis“ genannt worden (28.2): Substantiell ist sie, was ihr besonderer Liebling Odysseus nur sozusagen akzidentell ist, und zwar schon in der „Ilias“, nicht erst in der „Odyssee“. Als das Achäerheer, von Agamemnon in Versuchung geführt – des Krieges nach neun erfolglosen Jahren längst überdrüssig und voller Sehnsucht nach der Heimat –, wider dessen törichtem Erwarten Hals über Kopf zu den Schiffen stürzt, um sich davonzumachen, hat allein Odysseus – von Athene hier mit „πολυμήχανος“ = „erfindungsreich“ (Il. 2.173) angesprochen und diskret dazu aufgefordert, etwas dagegen zu unternehmen – seine Sinne beisammen behalten und sich von der allgemeinen Kopflosigkeit nicht anstecken lassen; energisch fährt er drein, aber findet auch die richtigen Worte, um seine Landsleute vom schmählichen Rückzug, unverrichteter Dinge, zurückzuhalten (vgl. 2.182 ff.) – diese beherzte und erfolgreiche Aktion ist natürlich ganz und gar nach Athenes Sinn, sozusagen beider gemeinsames umsichtiges Werk zum allgemeinen Nutzen, d. h. hier der späteren Eroberung und Zerstörung Troias.
Am wunderbarsten hat sich aber ihr innerstes Wesen überlegener Besonnenheit und klugen Ratgebens für die ihr verwandten, befreundeten Menschen in der berühmten Szene zu Beginn der „Ilias“ manifestiert, als sie den von Agamemnon bis aufs Blut gereizten Achill daran hindert, zum Schwert zu greifen und seinen gemeinen Beleidiger niederzumachen. Wie das geschieht und gelingt, ist sowohl für Homers Auffassung pathischen Erlebens aufschlussreich, das Denken eingeschlossen, als auch für sein Verständnis von Wesen und Wirken der Götter im Hinblick auf Handel und Wandel der Menschen. Achill, ergrimmt ob der Ehrabschneidung, erwägt noch, was er tun soll, zückt aber bereits das Schwert, um Agamemnon niederzuhauen – da packt ihn plötzlich Athene beim blonden Haarschopf; sichtbar ist sie nur ihm allein; er erschrickt, aber erkennt sie sofort: „Furchtbar („δεινός“; hier wohl eher mit „machtvoll“ zu übersetzen) strahlte ihr Auge” (Il. 1.200); vertrauensvoll redet er sie an, erkundigt sich, weswegen sie gekommen sei und erfährt zur Antwort:
„Deinen Zorn zu besänftigen, kam ich, ob du wohl hörtest,
Fern vom Himmel, gesandt von der lilienarmigen Here,
Die um beide zugleich in liebender Seele sich kümmert.
Aber wohlan, laß ruhen den Streit und das Schwert in der Scheide!
Aber mit Worten magst du ihn kränken, wie es dir einfällt!
Denn ich sage dir an, und das wird wahrlich vollendet:
Dreimal so herrliche Gaben empfängst du in künftigen Tagen
Wegen der heutigen Schmach. Drum faß dich und sei uns gehorsam!“ (Il. 1.207 ff.)
Und Achill besinnt sich und folgt beherrscht ihrem Rat.
Diese zu Recht berühmte Szene Gott/Mensch ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Was heutzutage als ein Akt von Besinnung und Selbstbeherrschung verstanden würde, hat Homer als Eingriff und Eingebung der Göttin erzählt. Entmythisiert würde das bedeuten: Achills plötzlicher Einfall zur Lösung des gegebenen Problems hat ihn einen Augenblick lang schier überwältigt und ihn dann umgestimmt. Sein Mit-sich-zu-Rate-Gehen ist zum Abschluss gekommen, er hat sich entschieden. Cool hat er veranschlagt, was ihm den größeren Vorteil einzubringen verspricht, und so wie er es sich überlegt hat, muss er nun handeln, seinem Charakter entsprechend. Denn durch Verstand und Charakter wird ihm die gleiche mögliche besonnnene Beherrschung seiner Triebe geschenkt, wie es der Göttin anstrengungslos substantielles Wesen ist. Kein untertäniger Gehorsam wird hier abverlangt oder gar erzwungen, nichts befohlen: Sein Handeln ist seiner eigenen freien, selbstbestimmten Entscheidung anheimgestellt, aber eben einer vernünftigen, wohl überlegten Entscheidung – „Wenn du mir folgen willst” (Il. 1.207). Doch unabdingbar folgt daraus auch: „Ίσχεο“ (Il. 1.214)! „Sammle dich!“ „Halt an dich!“ „Beherrsche dich!“ Und sinngemäß ergänze ich noch: Handle deinem Wesen gemäß! Dann wirst du gar nicht anders handeln können als im Einklang mit meinem und deinem Sinn und Sein. Hüte dich, in Wut einen Königsmord zu begehen, der dich teuer zu stehen käme! Warte geduldig deine Stunde ab! Und Achill hat die Kraft, sich zu überwinden, sich der vernünftigen Einsicht zu fügen. Das gehört sich so, sagt er (vgl. Il. 1.216) und begründet danach seine Entscheidung fromm im Sinne solchen Gottglaubens: „Wer dem Gebote der Götter gehorcht, den hören sie wieder” (Il. 1.218). Soll heißen: Besonnenheit, überlegtes Handeln verspricht erfolgreiches Handeln zu sein. Denn wie von der Göttin ausdrücklich ja auch empfohlen, hat der nüchtern-realistische Homer von einer großartig edlen Motivation kein Sterbenswörtlein verlautbaren lassen. Vielmehr handelt Achill, als er nunmehr handelt – er stößt das Schwert in die Scheide zurück und beschimpft seinen Widersacher aus voller Lunge –, allein aus schlauer Berechnung, indem er sozusagen Freuds Realitätsprinzip beherzigt: Hält er sich momentan zurück, lässt sich in Zukunft der größere Nutzen verbuchen. Denn nach Willen von Zeus, sprich von Homer, kann Troia nicht erobert werden, solange Hektor die Stadt verteidigt. Und einzig Achill ist Hektor gewachsen. Also braucht er nur noch abzuwarten, bis alle einsehen, dass es ohne ihn nicht geht – in welche Tragik er sich durch seine beherrschte Handlungsweise am Ende verwickelt hat, das konnte ihm von der Göttin freilich nicht vorausgesagt werden, weil das Sache der weder von Athene noch von Vater Zeus vollständig im Voraus wissbaren Moira oder denn des „allwissenden“ Dichters ist; und diesem ist anscheinend bewusst gewesen: Auch die besonnenste, wesensgemäßeste Entscheidung vermag ungewollte Nebenwirkungen und unvorhersehbare Zufälligkeiten nicht zu verhindern, denn diese gehören zur Domäne der allmächtigen, unvorhersehbaren Zeit.
All das erscheint mir außerordentlich bemerkens- und bedenkenswert, und es fällt dadurch nicht nur wieder helles Licht auf das früher bereits ausführlicher behandelte Problem Notwendigkeit/Freiheit, sondern es wird ebenfalls bekräftigt, dass von einer Lossprechung des Menschen für die Verantwortung an seinen Taten bei Homer keine Rede sein kann. Die Menschen sind keine freiheitslosen, von den Göttern an Schnüren geführten Marionetten, und nirgends wird hier mit scheelem Blick auf den menschlichen Egoismus geschaut: Selbstliebe ist ein Stück Naturnotwendigkeit, unveräußerlich und daher bejahenswert – vorausgesetzt, das Selbst, das geliebt wird, ist dessen wert. Stolz auf sich zu sein, falls durch Tat oder Werk berechtigt, ist keine Sünde. Auch die Götter sind stolz auf sich, sogar prahlerisch, und die ausgezeichneten Menschen sind es genauso, vornehmlich wieder Achill. Und um es nochmals zu wiederholen: Nur Lumpe sind bescheiden. Denn ihnen geht ab, worauf sie mit Recht stolz sein könnten, und daher sind sie niederträchtig, verachtenswert und anfällig für das gemeinste Ressentiment. Aristoteles hat es, wie schon gehört, auf den Punkt gebracht und damit die Summe des altgriechischen Ethos gezogen: „Der ethisch hochstehende Mensch soll sich also selbst lieben – denn von seinem edlen Handeln wird er selbst Gewinn haben und auch die andern fördern –, der minderwertige dagegen darf keine Selbstliebe haben, denn er wird sich selbst und auch den anderen schaden, da er seinen schlechten Trieben folgt“ (Nik. Eth.; 1169a). „Egoismus mit Schwäche verbunden”, wie Goethe sich in gleichem Sinn geäußert hat (vgl. seinen Brief an Zelter vom 20.10.1831), taugt nichts. Andere von sich leben zu lassen vermag nur, wer sich selbst liebend bejaht und sich innerlich reich gemacht hat, so dass die Reichtümer der Erde durch ihn hindurch auf andere überfließen können, ohne dass ihm deswegen Altruismus unterstellt werden müsste. Seine Zufriedenheit mit sich selbst wirkt wohltuend, wirkt wohltuend für ihn selbst wie für andere – doch wem sonst hätte er das zu verdanken als seiner Selbstliebe?
Auch die Gunst des Athene-Wesens wirkt sich auf diese Weise gedeihlich aus, gesetzt, der Mensch handelte ihm gemäß. Dank Weiterentwicklung ihrer homerischen Sophrosyne-Gestalt geistbeherrschten An-sich-Haltens, das sich von keiner Erregung, Gefühlswallung, Begehrlichkeit, Leidenschaft besinnungslos hinreißen lässt, das kühlen Kopf bewahrt und auf diese Weise zur angemessenen Einschätzung einer gegebenen Situation befähigt wird – Aristoteles hat die Sophrosyne definiert als Begehren des richtigen, also edlen (καλός) Ziels, in der richtigen Weise und zur richtigen Zeit (vgl. Nik. Ethik, 1109b) –, lassen sich alle weiteren ruhmwürdigen und durchweg menschenfreundlichen Eigenschaften Athenes und die daraus ableitbaren Zivilisationsgaben leicht nachvollziehen: Die bereits erwähnte Erfindung von Wagen und Zaumzeug zur Nutzung des Pferdes; das erste Schiff, die berühmte Argo; das hölzerne Pferd zur Eroberung Troias. Die Frauen verdankten „Athene Ergane“ ihr Wissen zur nützlichen Verarbeitung der Wolle und den gekonnten Gebrauch von Spindel und Webstuhl zur Verfertigung der Kleidung; zumal des kostbaren Peplos, der ihr von den Athener Frauen am Panathenäen-Fest ehrerbietig und dankbar dargebracht wurde, daher sie denn zusammen mit Hephaistos zur Patronin der Handwerker und aller praktischen Kunstfertigkeiten erklärt worden ist.
Bei alledem hat die Vater-Tochter und Männer-Freundin streng auf die getrennten Welten der Geschlechter geachtet. Rigoros sind die Frauen von ihr der Öffentlichkeit verwiesen worden, die Haus-Herrin hat allein den Haushalt zu besorgen und sich um die Kleinkinder zu kümmern. Ihr heiliger Baum ist die Olive, vielleicht ihr schätzenswertestes Geschenk an die Menschheit, da sich Stellenwert und Gesundheitsbedeutung des Olivenöls noch für die heutige mediterrane Küche kaum überschätzen lassen. Als ihr heiliges Tier gilt die Eule, schmückend aufgeprägt auf den Münzen ihrer Lieblingsstadt Athen und noch bis zur Gegenwart das kennzeichnende Bild des griechischen Euro – dass ihr übliches Schmuckwort bei Homer – „γλαυκώπις” = „eulenäugig“ – üblicherweise inzwischen und rechtens mit „blauäugig“, „helläugig“, „strahlenden Auges” übersetzt würde, wäre ich mir nicht gar so sicher: Vielleicht sollte man sie sich besser als rassig-mediterran und daher eulenäugig-braun vorstellen, oder mit dem Eulenauge hätte ihr scharfer Eulenblick bezeichnet werden sollen, der noch die Dunkelheit durchdringt – wer weiß?
In ihrer späteren Karriere hat Athene aber die parteiische Trübung ihres Blicks für die Achäer bei Homer jedenfalls überwunden. Dessen polytheistisch-heidnische Humanität und sein ausgeprägt realistischer Sinn hatten es ihm nicht erlaubt, die unveräußerliche Ambivalenz seiner vergöttlichten Naturmächte leichtfertig zu negieren, die ebenfalls für die Menschenwelt anzunehmen, bereits durch die simple Überlegung zu rechtfertigen wäre, dass im Krieg Sieg und Weiterleben des einen allemal Niederlage und eventuell Tod des anderen bedeuten. Chauvinistisch das Gute allein bei der eigenen Nation zu sehen und die Gegenseite dementsprechend zu verteufeln, hat Homer sich standhaft und erfolgreich geweigert, wogegen die sich von ihrem geoffenbarten Gott der absoluten Wahrheit versichert fühlenden Monotheisten da bis heute ihren blinden Augenfleck haben.
Doch allezeit ist Athene jedenfalls Geist vom wahren Geist geblieben, gezeugt vom Vater, nicht geschaffen: „Ganz gehöre ich zum Vater” (Eum; 738), hat es noch Jahrhunderte nach Homer Aischylos festgehalten, der ihr mit seinen „Eumeniden“ ihr schönstes Preislied gesungen hat. Doch bei dem Tragiker dürfte das bereits gleichsinnig mit Zeus’ Erhebung zum Garanten einer sittlichen Weltordnung geschehen sein, eine Errungenschaft des theologischen Denkens seit Zeiten Solons. Wenn daher von Aischylos die überlegene Weisheit der Göttin zu gerechtem Ausgleich von scheinbar unvereinbaren göttlichen Machtansprüchen durch Schaffung menschlich-institutionalisierter Rechtsgleichheit in Anspruch genommen worden ist, so war Athene damit wohl längst wesensgleich mit Athen geworden, zum guten Zeus-Geist ihrer Lieblingsstadt. Zu ihrer höchsten Ehrung, aber natürlich auch zum Ruhm für sich selbst und seine Mitbürger, ist ihr dann von Perikles ihr allerschönstes Haus auf der Akropolis gebaut worden, worin sie für alle Bürger glanzvoll sichtbar in Gestalt der berühmten Goldelfenbeinstatue des Phidias als „Athena Parthenos“ wunderbar hauste. Von einem naiven Götterglauben wie zu Zeiten Homers, von dem ich ihn selbst aber, wie öfters betont, gerne ausnehmen möchte, war man damals bestimmt seit langem abgerückt. Als dann Sophokles in seinem erhaltenen Erstling „Aias“ – dies einzige Mal überhaupt in seinem erhaltenen Oeuvre – eine Gottheit auf der Bühne hatte auftreten lassen, nämlich ausgerechnet Athene als homerisch-parteiische Feindin des großen Aias zugunsten ihres Lieblings Odysseus, hat er sie nach Jahrhunderten wieder als genauso heimtückisch und betrügerisch dargestellt und verurteilt, wie es Homer beim letzten Kampf zwischen Achill und Hektor zum fragwürdigen Ruhm der allzu blind-parteiischen Göttin vorexerziert hatte – inzwischen verdiente aber wohl die edle Gesinnung ihres menschlichen Feindes ungeteilt die höhere Achtung.
Homer hatte es noch eher bei der Indifferenz der vergöttlichten Naturnotwendigkeit bewenden lassen. Den beiden späteren Tragikern, nachdem seit Aischylos’ Plädoyer für eine Art sittlicher Weltordnung das Theodizee-Problem unlösbar geworden war, so man sich an die Erfahrung halten wollte, ist aufrichtigerweise wohl kaum etwas anderes übriggeblieben, als zum Atheisten zu werden wie Euripides oder zumindest, wie Sophokles, mit Schauder und Entsetzen die verstörende Rätselhaftigkeit des Weltwesens zu bekennen, meinetwegen der Götter, gesetzt, man glaubte noch an sie. Bei Perikles schließlich gipfelte dessen Lobeshymne auf seine Vaterstadt zwar in einem Preislied auf die charakteristischen Tugenden der Göttin. Doch bei Licht besehen hat er von rein menschlichen Eigenschaften und dem seinen Mitbürgern von ihm angesonnenen Ethos gesprochen, also vom notwendig hohen Sinn, Kalaphrónesis, für den gemeinsamen, erfolgversprechenden Schutz der Stadt (vgl. Thukydides; 2.62) und von realistischem, zu Tat und Tod bereitem Wissen (ebd.) als unerlässlichem Anspruch an die Athener, wenn sie überleben wollten – und gedacht hat er dabei wohl an so etwas wie die Phronesis der Philosophen, ein vernunftbestimmtes, verantwortetes Ethos, von Göttern und Athene ist weiterhin überhaupt nicht mehr die Rede. Auch Thukydides selbst, der Gewährsmann für diese Ansichten und Forderungen von Perikles, hat die Götter kühl schweigend übergangen, allenfalls hat er seinen wertgeschätzten Perikles sich nüchtern einmal verlautbaren lassen wie ehedem Homer: „Götterfügung muss man mit Gelassenheit tragen” (2.64) – aus der Göttin Athene ist hier längst Psychologie und das humane Ethos der Polis Athen geworden.
Die bildende Kunst hatte damit natürlich nicht Schritt zu halten vermocht, sie verharrte eisern bei den Göttern Homers und konnte nur deren Anspruch in ständiger, zunehmend verschönerter Wiederholung zu vergegenwärtigen suchen: Vollkommene Leibsgestalt als Symbol machtvollen Geistadels – und zufolge meiner Auswahl nur je eines einzigen Kunstwerks zur Verbildlichung des komplexen Wesens der griechischen menschengestaltigen Gottheiten sehe ich mich auch im Falle Athenes zur Beschränkung auf nur einige wenige ihrer mannigfaltigen Charakterzüge gezwungen.
Auf bewusster Metope aus Olympia und auch einigen weiteren dort gefundenen wird Athene vornehmlich als hehre Helferin vorgestellt, die dem Kulturbringer Herakles treu zur Seite steht. Als urzeitlicher Heros war dieser im Vergleich zum späteren Athene-Schützling Odysseus noch eher durch seine übermenschlichen Kräfte ausgezeichnet: Nur dadurch hatte er es beispielsweise geschafft, den lernäischen Löwen, ihn niederringend, zu überwinden und sich symbolisch mit dessen abgezogenem Fell – sein hernach typisches Kleidungsstück – demonstrativ auch noch die Stärke des Löwen anzueignen. Doch gelegentlich erscheint er auch durchaus bereits von Athenes kluger und erfindungsreicher Art beseelt und wusste sich aus schier aussichtsloser Lage verständig zu helfen, etwa, als er den Riesen Antaios im Ringkampf nicht zu besiegen vermochte, weil dieser bei jeder Berührung mit seiner Mutter Erde neue Kraft schöpfte – kurzerhand hat er ihn daher vom Boden hochgehoben und so erwürgen können; oder die wiederholt abgeschlagenen, aber immer frisch nachwachsenden Köpfe der Sumpfschlange von Lerna hat er clever ausgebrannt – vermutlich eine dunkle Erinnerung an landgewinnende Kulturtaten durch Trockenlegung von Sümpfen, die es in der Gegend von Lerna tatsächlich gegeben hatte; oder er hat – wie es auf einer weiteren Metope vom Olympiatempel wieder mit der ihm die intelligente Lösung des Problems hellwach weisenden Athene dargestellt worden ist – ohne Umschweife einen ganzen Fluss durch die von Misthaufen verpesteten Kuhstallungen des Augias umgeleitet und den elenden Auftrag auf diese Weise gewitzt und elegant ausführen können, ohne sich dabei wie ein Banause die Hände schmutzig zu machen. Treu hat er auf diese Weise mit all seinen Großtaten Wesen und Willen seines längst zur Menschenfreundlichkeit bekehrten Zeusvaters gedient: Umschaffung der Natur zum kulturellen Nutzen des Menschen durch brachiale Ausrottung der alten mythischen, menschenlebenfeindlichen Ungeheuer, auch den archetypischen Menschenfreund Prometheus hat der Kulturheros endlich von der zügellosen Bestrafung durch den früher tyrannischen Zeus befreit – dass ihm bei diesen menschendienlichen Taten, die ihm als einzigem Sterblichen zuletzt die Versetzung unter die Olympischen eingebracht haben, Athene, die mit ihrem Zeus-Vater gleichgesinnte Tochter, hilfreich zur Seite gestanden hatte, war eine fast zwangsläufige Schlussfolgerung des Mythos gewesen.
Weil nun Herakles die Paradiesesäpfel der Hesperiden nicht selber pflücken konnte – sie zu holen, war ihm aufgetragen –, da das seinen sicheren Tod bedeutet hätte, hat er den Titanen Atlas gebeten, ihren Nachbarn oder ihren Vater, das – bitte schön! – für ihn zu besorgen – bekanntermaßen trug Atlas das Himmelsgewölbe auf seinen starken Schultern und galt dazu als besonders schlau. Derweil dieser also losging, die Äpfel zu holen, hatte nun Herakles die überschwere Last zu tragen – praktisch hat er sich auf unserer Metope ein Kissen zur Linderung des Druckes auf seine Schultern gelegt, aber der Kopf wirkt doch schwer gebeugt unter der Last. Und womöglich wäre dies Gewicht selbst für diesen Kraftprotz, den Stärksten der Starken, zu schwer gewesen, hätte ihn Athene nicht mit leichter Hand, fast spielerisch wirkend, beim Tragen unterstützt – kein Zweifel, dass in Wahrheit sie die Hauptlast tragen sollte. Völlig aufrecht, regungslos, wie unbeteiligt an der ganzen Szene, steht sie hinter Herakles, der sie infolgedessen gar nicht sehen kann, doch in seinem innersten Wesen sich wohl allzeit ihres Beistands vollkommen bewusst und sicher war, weil ein gut Teil davon als Erbschaft ihres gemeinsamen Vaters auch in ihm steckte. Athene ist völlig von ihrem Peplos verhüllt, der die Konturen ihres Körpers kaum erahnen lässt – dadurch eignet der statuarischen Gestalt etwas von der ihr wesensgemäßen Klarheit und Stärke einer dorischen Säule. Doch durch das Gewand, wunderschön längs gefältelt, zweiteilig, wirkt ihr Körper auch hoheitsvoll gestreckt und weiblich-weich, ionisch umhüllt. Ohne jede Anspannung liegt der linke Arm an ihrem Körper an. Ihr Kopf ist zwar in Richtung des Geschehens gewendet, so dass sich ein überaus feines, klassisches Profil erblicken lässt, aber man gewinnt dadurch nicht den Eindruck, als ob ihr Blick von der Szene gefangen gehalten würde. Der Gesichtsausdruck wirkt ruhig, ernst, freundlich, völlig unangestrengt. Die einzigen Gebärden, die ihre Beteiligung bezeugen, sind der gebeugte Arm und die nach oben flach ausgestreckte Hand, mit der sie anmutig, wie beiläufig, mühelos, den Freund unterstützt – vielleicht gibt es kein zweites Kunstwerk, wodurch die himmlische Leichtlebigkeit, aber auch vollständige Selbstgenügsamkeit der homerischen Olympier so ungezwungen, in der berückenden Einfachheit und Ausgewogenheit klassischer Schönheit, zu Ausdruck und Darstellung gebracht worden ist. Und selbst ein Quäntchen von geistiger Souveränität, wenn hier auch nur in Form märchenhafter Gewitztheit, mag in den Zauber der Gesamtszene noch mit hineingesehen werden dürfen, da der weitere Verlauf der Geschichte ja bekannt ist.
Brav hat Atlas die Äpfel zwar angebracht und weist sie vor, aber ist weder willens, sie Herakles zu überreichen, noch dazu, sich die schwere Last des Weltalls wieder auf seine Schultern zu laden. Gerissen täuscht Herakles Einverständnis vor, nur möchte Atlas für einen Augenblick noch mal übernehmen, damit er sich das Schulterkissen bequemer richten könne – und der in Wahrheit dumme Riese ist selbstredend auf diese Menschenlist hereingefallen: Herakles denkt gar nicht daran, ihm die Last wieder abzunehmen und zieht mit seinen Paradiesesäpfeln erleichtert seines Weges, nach einer überlieferten Version des Mythos soll er sie zum Dank dann Athene geschenkt haben – er ist also doch kein bloßer Muskelprotz gewesen, sondern dankbar hohen Sinns um seine Verschuldung gegenüber der Göttin wissend, wie es sich für einen Sohn des Geistvaters Zeus gehört.
A p h r o d i t e
Bislang sind ausschließlich die drei höchstrangigen Geistgötter Homers behandelt worden. Weitere könnten ihnen zur Seite gestellt werden, zumal die stark von deren hehrer Geistigkeit abweichende des diebisch-derbhumoristischen, gewitzigt-trickreichen Hermes; oder diejenige der – wenn auch von ihrem Herrn Gemahl mitunter despotisch geduckten – Hera, die gleichwohl eine ihrem Zeus ebenbürtige, machtvolle Herrin in ihrem Bereich ist und herzerfrischend beispielsweise dem keck ihr entgegentretenden Pfeil-Mädchen Artemis – abermals von anderer, eigener Geistigkeit – ihren Bogen um die Ohren schlägt, um klarzustellen, wer in der Welt der Frauen das Sagen hat. Anstatt mich aber des sämtlichen Olympiern gleichartigen, wenn auch je unterschiedlich eigenen Geistwesens weiter anzunehmen, möchte ich aus Kontrastgründen als vierte olympische Gottheit lieber noch die „χρυσέη Αφροδίτη“, die „goldene Aphrodite“ (Hesiod: Theogonie; 823, 962; vgl. Hom. Hymn., 1.9: „πολύχρυσος“ = „vielgolden“) zu konterfeien versuchen, der Homer wegen ihrer – die menschliche Vernunft allzu leicht störenden und nicht selten verstörenden, ja völlig überwältigenden –, vergleichsweise geist-unaufgehellten Naturmächtigkeit mitunter übel mitgespielt, ja, sie sogar lächerlich gemacht hat, ohne damit allerdings ihren Machtanspruch im geringsten in Frage gestellt zu haben, genauso wenig wie den ihres Geliebten Ares, der ansonsten aber wegen seiner ungestümen Art von Homer ebenfalls nicht gerade gerühmt und unter die Geistgötter gerechnet worden ist.
Dass jedenfalls die goldene Aphrodite, „die das Lächeln liebt” (φιλομμειδής; Hom. Hymn., 17.49), nicht zum männermordenden Kriegshandwerk taugt, dürfte einleuchtend sein. Daher verdient sie allen Spott Homers, da sie, von Diomedes’ Lanze leicht an der Haut geritzt, ihren Sohn Aineas, in Panik geraten, herzlos aus den Armen fallen lässt, als sie den durch einen mächtigen Felsbrocken von der Hand des Gegners schwer Getroffenen, Ohnmächtigen, aus dem Schlachtengetümmel wegzuschaffen suchte, so dass Apollon ihr zu Hilfe eilen musste, um das Schlimmste zu verhüten (vgl. Il. 5.324 ff.); oder als Athene, der sie sich fahrlässig zum Kampf stellte, „sie mit kräftigem Arme / Gegen die Brust … schlägt, daß gleich die Knie und das Herz ihr erschlafften” (Il. 21.424 f.) – denn in Kampf und Krieg ist sie schwächlich (vgl. Il. 5.331), wie auch von Zeus bestätigt wird (vgl. Il. 5.428), ihre Stärke liegt wahrlich auf anderem Gebiet, aber wohl unstrittig auch nicht in der Geistsphäre. Und dieser Göttermacht hatte auch ein Homer seinen Tribut zu zollen, so leidenschaftlich er das eher Ungeistig-Irrationale ansonsten in den Hintergrund zu drängen suchte.
Beispielsweise der aufmüpfigen Helena, nach der schmählichen Niederlage ihres Paris im Zweikampf mit Menelaos, hat der Dichter die Göttin sich als übermächtige, gegebenenfalls dämonisch-grausame (vgl. Il. 3.399) und arglistige (vgl. Il. 3.405), jedenfalls unwiderstehliche Macht offenbaren lassen, die der enttäuschten Frau zornig die Leviten liest, da diese sich zu weigern wagte, zu ihrem feigen Gatten sogleich wieder ins Bett zu springen. Doch dem herrischen Gebot der Göttin hatte sie dann schlechterdings nichts entgegenzusetzen, das Aphrodite-Wesen hatte sie „in der Tiefe des Herzens” getroffen (Il. 3.395) und ein brünstiges Verlangen in ihr entfacht, mit dem Gatten das Lager zu teilen. Zu ihrer Überwältigung und völligen Kapitulation hatte ein ihr von der Göttin zauberisch vorgegaukeltes Bild von Paris völlig ausgereicht, der auf schön gedrechseltem Lager (vgl. Il. 3.391) sehnsüchtig ihrer Umarmung harren würde. Erkannt hatte Helena die Göttin zuvor, obwohl diese sich in eine greise Alte verwandelt hatte, an dem „lieblichen Nacken”, an ihrer „reizenden Brust” und den „anmutsstrahlenden Augen” (Il. 3.396 f.).
Dem Liebreiz des Geschlechts in vollkommener Schönheit verdankte demnach Aphrodite ihre wahre Macht und Wirkung. Hesiod hatte von ihrer allerheiligsten Geburt nach seiner derben Bauernart erzählt, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. In den späteren moralischen Christenohren dürfte seine Geschichte schamlos und unflätig oder gar blasphemisch geklungen haben, aber bestimmt hat er sich dabei ganz im Konsens mit den Ursprüngen der uralten Göttin befunden. Und Nietzsche hat – mag sein, etwas überzogen – den Griechen sogar nachgerühmt, allezeit sei für sie das „geschlechtliche Symbol das ehrwürdige Symbol an sich“ gewesen; „erst das Christentum … (habe) aus der Geschlechtlichkeit etwas Unreines gemacht: es warf Koth auf den Anfang, auf die Voraussetzung unseres Lebens” (Götzendämmerung: Was ich den Alten verdanke; 4). Ganz unverblümt hatte sich Hesiod damals geäußert: Aphrodite sei „geschlechts-liebend, weil sie aus dem Geschlecht ans Licht trat” (201 f.). Sollte heißen: Sie entstand aus dem Geschlechtsteil des Uranus, das ihm sein Sohn Kronos mit scharfer Sichel abgetrennt und ins Meer geworfen hatte. Aus dem ringsumher entstandenen weißen Schaum „wuchs ein Mädchen” (192), die „hehre, herrliche Göttin“ (194). „Trautes Mädchengeplauder und Lächeln und Trug, süße Lust, Umarmung und Kosen“ (205), das sei die schöne Domäne der Göttin.
Ohne Frage muss Aphrodite für älter als Zeus und alle übrigen Olympier angesehen werden, daher man Hesiods Angaben in ihrem Fall mehr Vertrauen entgegenbringen kann als denjenigen Homers: Aphrodite darf als griechische Nachfahrin der matriarchalen großen Göttinnen Asiens gelten, der Ischtar, Astarte, Anahit: Himmelskönigin und Gattin des Königs, aber auch Dirne. Vermutlich ist sie via Kreta oder Zypern aufs Festland importiert worden, als Wesenheit von Geschlecht und fruchtbarem Leben reicht sie weit zurück in Vorbronze-Zeiten. Bezeichnenderweise sind im griechischen Mythos ihre mütterlich-gebärerischen Aspekte aber stark in den Hintergrund getreten, auch von Hesiod ist ihr der Eros nicht etwa als Sohn zugeordnet worden, er hat ihr nur das festliche Geleit auf den Olymp gegeben (vgl. 202). Denn Eros ist ja in Wahrheit noch uranfänglicher als sie, ist der kosmogonische Eros, der „alles begonnen” – doch im Übrigen gehören natürlich Liebreiz des Weibes und männliches Begehren, Aphrodite und Eros, polar und untrennbar zueinander. Hesiod hat Eros „den schönsten der unsterblichen Götter“ (genannt), „den Glieder lösenden, der allen Göttern und Menschen den Sinn in der Brust überwältigt und ihr besonnenes Denken” (122 f.). Solange also Aphrodite nicht gleichfalls in dieser kosmischen Dimension einer alles und alle überwältigenden, uranfänglichen Macht gesehen wird, ist Wesentliches von ihr nicht zu begreifen, auch nicht, weswegen ihr von Homer in allzu geistverhafteter Abwehrhaltung kaum mehr als ihre reizende Anmutsgestalt gelassen wurde. Nur bei Berücksichtigung dieser Auspizien dürfte auch der unbändige Hass zu erklären sein, den die Herrschaftsgöttin Hera und die Weisheitsgöttin Athene, beide männerparteiisch, in der „Ilias“ gegenüber der “hündischen Fliege” (Il. 21.421) hegen, wie sie unfein von Hera einmal genannt wird, nämlich seit dem für beide schmachvollen Parisurteil, weswegen zumindest Hera danach den Untergang Troias mit allen, auch unfairen, schändlichen Mitteln zu betreiben gesucht hat, koste es, was es wolle.
Und vielleicht reicht zur Erklärung des unversöhnlichen Hasses der beiden Göttinnen auf ihre Konkurrentin nicht einmal die psychologische Finesse eines Euripides aus, der ansonsten mehr von der Macht des Irrationalen, zumal auch Aphroditens, begriffen, zumindest dargestellt hat als wohl irgendein Grieche vor ihm und nach ihm. In der von ihm bevorzugten, seinen Stücken gemäßen Manier von Rede und Gegenrede, hat er in seinen „Troerinnen“ leichthin zunächst Helena alle Schuld auf Aphrodite abwälzen lassen. Daraufhin wird ihr schneidend von Hekabe, Paris’ Mutter, entgegengehalten, in Wahrheit habe wohl der asiatisch-üppige Prinz ihre gemeine Begierde entfacht, so dass sie gar nicht von ihm hätte verführt und entführt zu werden brauchen:
„Mein Paris glänzte Göttern gleich an Wohlgestalt;
Da du ihn sahest, ward zur Kypris dein Verstand,
Denn ‚Aphrodite’ heißt uns alles Törichte,
Und richtig meint ihr Name ‘Unvernunft’.
Ihn sahst du golden strahlend in barbarischen
Gewanden prunken, und in Lust entbranntest du.
Denn Argos, wo du weiltest, bot dir weniges;
Von Sparta scheidend, hofftest du, die Phrygerstadt,
Von Golde strömend, werde dir im Übermaß
Genüsse spenden, weil des Gatten Haus dir nicht
Genügte, schwelgend deine Gier zu sättigen” (988–998).
Entlarvend psychologisch ist das bestimmt einwandfrei geurteilt. Aber ich glaube, dass es, grundsätzlich gesehen, noch um mehr bei der heftigen Abwehr des Aphroditewesens gegangen ist, nämlich um das gefährliche Wagnis der Abnabelung des männlichen Europa vom mütterlich-weiblichen, auch hierodulichen Asien – zumal bei Besprechung von Aischylos’ „Orestie” ist darauf ausführlicher zurückzukommen. Einstweilen mag es genügen, sich um eine Antwort auf die Frage zu bemühen, weswegen die von Paris verschmähten Hera und Athene derart hasserfüllt parteiisch auf Seiten der Griechen standen. Weil hier, antworte ich, in Gestalt des reizenden Troianer-Feindes, die libidinösen, auch Heras Ehe-Schutz gefährdenden Werte der großen asiatischen Kupplerin-Herrin dem heldisch-griechischen, disziplinierten Athenegeist ostentativ vorgezogen worden waren, mithin von Paris wie Helena der Liebesgöttin der höhere Rang zugebilligt wurde. Durch Homers Herabwürdigung alles Irrationalen, zumal von Aphrodite und Dionysos, ist dem Abendland eine schwere Erblast aufgeladen worden, nach Kräften hatte er zugunsten seiner männlichen Geistgötter, mitsamt jungfräulicher Athene und Artemis, die große Göttin, die Uranfängliche, die Mutter allen Lebens durch das Geschlecht, vom Thron zu stürzen getrachtet. Seine Hochschätzung der Jungfräulichkeit bei Athene und Artemis lässt sich wohl doch kaum anders denn als entschiedene Absage an die, das Geschlecht und die Fruchtbarkeit des Lebens über alle geistig-moralischen Einschränkungen stellende asiatische Muttergottheit verstehen – auch Hera wird nirgends als liebende Mutter vorgestellt, ihren hinkenden, ungestalten Sohn Hephaistos beispielsweise hat sie höchstselbst vom Olymp ins Meer hinunter geworfen. Artemis muss als Inbild des blutjungen, von der Sexualität noch unberührten, spröde-keuschen Mädchens im Werte-Gefängnis des strengen Patriarchats gesehen werden, Athene als die etwas ältere Kameradin der Jünglinge, eine Art Kumpanin bei der körperlichen Ertüchtigung und ersten kriegerischen Unternehmungen wie etwa in Sparta. Durch die Vertrautheit des tagtäglichen Umgangs miteinander, hat man sich psychologisch richtig ausgedacht, war sie für die jungen Männer daher ohne sexuellen Reiz, eher so etwas wie eine geschwisterliche Freundin. Und sie selbst wäre wohl auch lieber ein Mann gewesen, denn dass sie sich zu Ehefrau und Mutter geboren gefühlt hätte. Eine dritte im Bunde war die im Gelöbnis ewiger Keuschheit gebundene Hestia, Typ Priesterin oder Nonne, geschlechtslos und abstinent – diese drei seien denn auch die einzigen gewesen, wie der homerische Aphrodite-Hymnus vorgibt (vgl. Vers 7 ff.), die der Gewalt der Aphrodite nicht unterworfen waren, die Männer dagegen also ausnahmslos, selbst Zeus weiß davon ja sein Lied zu singen: An sich ist Aphrodite also die Allherrscherin, wie sie auch der Anfang des Gedichts zu ihrer Ehre hymnisch gefeiert hat:
„Nenne mir, Muse, die Taten von Aphrodite, der goldnen
Kypris, die die Götter mit süßem Sehnen beseligt
Und auch die Geschlechter der sterblichen Menschen bewältigt,
ja, auch alles Getier, die luftdurchfliegenden Vögel,
alles, was rings dem Land und dem Meere entsprossen:
Kythereia gehorchen sie alle, der prächtig bekränzten“ (Liebesdichtung der Griechen und Römer, S. 19).
Im weiteren Verlauf des Hymnus ist hauptsächlich von der Liebschaft der Göttin mit dem asiatischen Hirten Anchises die Rede, Vater des Aineas. Und so wunderschön sich das alles anhören mag: Von der gewaltigen Herrin des Himmels und der Erde, der Urania oder ihrer asiatischen Vorgängerin Astarte, ist dabei herzlich wenig übriggeblieben, alles wirkt eher verspielt, idyllisch. Um den sterblichen Mann nicht einzuschüchtern, dem sie sich liebend naht, hat sie menschliche Gestalt angenommen und sich in ein züchtiges Jungfräulein verwandelt, auf ihren reichen Schmuck aber lieber doch nicht verzichtet. Er merkt zunächst nichts von einer Göttin, sie tischt ihm ein Lügenmärchen auf, aber natürlich ist sie ganz und gar unwiderstehlich:
„Trug sie doch ein Kleid, das hell wie Feuer erstrahlte,
reich umwunden mit Schmuck und leuchtenden Ohrgehängen.
Ihren zarten Nacken umschlang ein köstlich Geschmeide,
goldig und schön und schimmernd in Buntheit, und über den zarten
Brüsten glänzte es gleich dem Mond, ein Wunder zu schauen” (86 ff.; S. 25).
Und Anchises hat der scheinbar keuschen Verführerin schlechterdings nichts entgegenzusetzen:
„Die lächelnde Aphrodite
wandelte abgewandt mit niedergeschlagenen Augen
zu dem gebreiteten Lager des Fürsten, wo es schon vorher
ihm aus weichen Decken bereitet, aber darüber
lagen die Felle von Bären und lautaufbrüllenden Löwen,
die er selber früher erschlagen auf ragenden Bergen.
Aber nachdem sie sodann das treffliche Lager bestiegen,
nahm er ihr zuerst vom Leib das helle Geschmeide,
Spangen, gewundene Bänder und Ohrgehänge und Ketten,
löste ihr dann den Gürtel und tat ihr die glänzenden Kleider
ab und legte sie nieder auf silbergenageltem Sessel,
er, Anchises. Und dann, nach Schickung und Willen der Götter,
ruhte der Sterbliche ahnungslos bei der ewigen Göttin” (152 ff.; S. 29).
In Nachfolge solcher Rühmung der goldenen, der lieblich-lächelnden, der verführerisch-liebreizenden Göttin wäre in Sonderheit Sappho zu nennen – das soll an gehöriger Stelle auch ausführlich geschehen. Aber aus dem einzigen völlig erhaltenen, Aphrodite direkt geweihten, großen Gedicht, und ebenfalls aus den beiden weiteren beigefügten Gedichten von Archilochos und Anakreon, mag sehr wohl auch noch eine tiefere Ahnung der Lyriker vom machtvollen Wesen der Göttin herauszuspüren sein, wenn die Dichterin beispielsweise, eifersüchtig auf einen männlichen Rivalen, die Wirkung beim Anblick eines geliebten Mädchens auf sie schildert:
„Mir aber, ach, erschreckte
dies im Busen wahrlich das Herz; denn schau ich
flüchtig nur hinüber zu dir, versagt mir
völlig die Stimme,
und mir ist die Zunge gelähmt, ein feines
Feuer unterläuft mir die Haut urplötzlich;
mit den Augen sehe ich nichts, ein Dröhnen
füllt mir die Ohren,
und der Schweiß rinnt nieder, und meinen ganzen
Leib befällt ein Zittern, und bleicher bin ich
als das Gras, und nahe bereits dem Tode
schein ich” (Liebesdichtung der Griechen und Römer, S. 45).
Oder wenn sie den Eros beschwört, der sie „beugt und biegt, … den gliederlösende(n),…das süßbittere, rettungslose Untier” (S. 57).
Oder wenn der als verspielt geltende Anakreon gesteht:
„Wieder schlug mich
mit der Wucht des schweren Hammers Eros,
wie ein Schmied; lösch-
te mir dann die Glut in grimmer Eisflut” (zit. Bruno Snell: Die Entdeckung des Geistes, S. 73).
Oder wenn Archilochos klagt:
„Doch gliederlösend zähmt, Gesell, mich das Verlangen.
…
Und elend lieg ich in Verlangen
entseelt, von grausamen Wehen nach Götterwillen
durchbohrt bis ins Gebein.
Ein solcher Liebesdrang hat, unters Herz verknäult,
mir vieles Dunkel übers Aug ergossen,
da er mir aus der Brust die sanften Sinne stahl” (Liebesdichtung der Griechen und Römer, S. 39).
In diesen Gedichtfragmenten scheint mir von der lieblich lächelnden Aphrodite ein Schleier wie weggezogen zu sein: Es wird wieder etwas von der wilden Urmacht sichtbar, die Götter und Menschen und den gesamten Kosmos beherrscht – zugegebenermaßen habe ich ihr zur Erreichung solchen Eindrucks Eros gedanklich zugesellt, und zwar nicht als tändelnden Amor und Liebespfeilchen verschießenden Putto, sondern als die weltzeugende Urmacht, die ihr vereinigendes Band um alle Wesen schlingt. Doch weiblicher Liebreiz und männliche Begierde gehören ja nun mal zusammen, damit es zu „Platos Zeugung im Schönen” kommt: Noch das Widerstrebendste vermag Eros zu vereinen, damit das Leben durch Zeugung und Geburt ewig fruchtbar bleibt. Im Übrigen wäre auch noch zu berücksichtigen, dass Aphrodite und Eros, wie schon von der „Lesbierin“ Sappho bezeugt, den Griechen selbstredend auch als Urheber und Anstifter der gleichgeschlechtlichen Liebe gegolten haben, mithin auch für den Liebreiz der Jünglingsgestalt im schönheitstrunkenen antiken Griechenland einstanden.
Als gunstvolles Geschenk der goldenen Aphrodite mag daher die nackte Schönheit einer Kouros-Statue oder eines Apollo oder Hermes die Liebhaber ebenso bezaubert haben wie die erst viel später geschaffenen nackten Statuen von ihr selbst – laut Überlieferung hat Praxiteles die früheste ca. 350 v. Chr. zu bilden gewagt, die knidische Aphrodite. Danach ist dann der Bann gebrochen gewesen für die Karriere zahlloser Skulpturen einer zu wollüstiger Betrachtung und Begattung reizenden weiblichen Nacktheit, Typ Venus, die gschamig ihre Reize zu verbergen sucht, um nur noch verführerischer zu wirken. Und später ist man gar mit einem schon etwas obszön wirkenden Kallipygos-Typ herausgekommen: „Die mit dem schönen Hintern“ – beinahe war man damit schon bei den sexy Pin-up-Girls Hollywoods gelandet, mit ernsthaft religiösen Ambitionen hatte das längst nichts mehr zu schaffen. Deswegen brauchte der Liebreiz vieler dieser Figuren aus nachklassischer Zeit keineswegs in Zweifel gezogen zu werden, etwa in Gestalt der hinreißenden Schönheit eines vollkommenen weiblichen Körpers wie desjenigen der Venus von Milo. Doch von der kosmischen Urgewalt noch der asiatischen Allgöttin hatte man sich unterdes weltenweit entfernt, die Herrin und Hure zugleich gewesen war und der das Leben ewiglich Entstehen wie Vergehen verdankte: Urälteste der Moiren (vgl. Kleiner Pauly, S. 429), die den Menschen ihr Schicksal zuspann; „Pandemos“, nicht im späteren Sinn niederer, gemeiner Liebe, sondern der erotischen Verbundenheit einer ganzen Nation (von „nasci“ = „geboren werden“), alle miteinander die gemeinsamen, in Liebe geeinten Kinder der einen Mutter, nicht des Vaters im Geiste.
Dergleichen war in der nachhomerisch antiken Welt notorisch männlichen Wertevorrangs nicht gut mehr zu erwarten, ist Aphrodite um ihre frühere universale Mächtigkeit doch bereits durch Homers Menschengestaltgebung seiner Olympier gebracht worden, der ihr dazu noch der übrigen angeborenen Geistcharakter weitgehend vorenthalten hatte. Um dennoch einen angemessenen Eindruck von ihrer im Liebeserlebnis erfahrenen Allgewalt zu vermitteln, aber sozusagen im unvermeidlichen Gewande griechischer Schönheitsanbetung, habe ich ein Bildwerk ausgewählt, von dem ich mir diese Wirkung auf den Betrachter noch am ehesten versprechen könnte – auch Homer hatte es sich ja keineswegs versagt, den betörenden Zauber, der selbst von dem gestickten Gürtel der holdseligen Aphrodite ausging, in höchsten Tönen zu preisen: Sie löste ihn sich vom Busen und reichte ihn nichtsahnend zum lieblosen Machtmissbrauch der heimtückischen Zeusgemahlin; in dem „wunderkräftigen Gürtel waren … farbig die Reize des Zaubers gewoben / Alle: Liebe, Begierde, betörendes Liebesgeflüster, / Schmeichelnde Bitte, die selbst dem Verständigsten raubt die Besinnung” (Il. 14.214 ff.) – Zeus, wie bereits berichtet, nicht ausgenommen. Und als Voyeur der nackten Göttin hätte wohl kaum ein Mann nicht liebend gern der Rede des losen Hermes beigepflichtet, als dieser, von Apollon gefragt, ob er wohl wie Ares, in flagranti ertappt und in den Fesseln Hephaistos’ mit Aphrodite vereinigt, Scham und Schande preisgegeben, in den Armen der lieblichen Göttin liegen wolle, zu homerischem Gelächter der versammelten Götter zur Antwort gab: „Wenn dieses doch geschehen möchte, Herr! Fernhintreffender Apollon! Da möchten Bande, dreimal soviel, unendliche, um mich herum sein und ihr zuschauen, Götter und Göttinnen alle: gleichviel! Ich schliefe bei der goldenen Aphrodite!“ (Od. 8.340 ff.). Und als Wirkung des ausgesuchten Bildnisses mag sich gar womöglich eine Ahnung davon einstellen, was mit dem passiert, der Aphrodites Macht nicht anerkennt und ehrt, der die Liebe hochmütig verschmäht wie weiland Hippolytos, der keusche Verehrer der keuschen Artemis: Aus Rachsucht ließ die Göttin seine Stiefmutter Phädra, Gattin des Theseus, in leidenschaftlicher, wahnsinniger Liebe zu ihm entbrennen, um sie sich dann, da der schöne Jüngling partout keine Augen für sie hatte, selbst den Tod zu geben und ihn durch falsche Beschuldigung mit sich in ihren Untergang zu reißen.
Mit Mitteln der klassischen Bildkunst Griechenlands ließ sich derartiges allerdings nicht darstellen, und so mag es auch aus dem Bildwerk, das ich ausgewählt habe (Abbildung), nicht ohne weiteres herausgesehen, aber etwas davon mit weiterem vielleicht doch hineingesehen oder herauserlebt werden können. Jedenfalls gibt es meiner Ansicht nach kein Werk griechischer bildender Kunst, wodurch die göttliche Majestät wie der Liebreiz überwältigend schönster, reifster Aphrodite-Weiblichkeit übertroffen würde, mit der die Liebesgöttin auf dem Parthenon-Giebel im Schoße ihrer Mutter Dione hoheitsvoll gelagert ist. Die kühle Nacktheit von Giorgiones Venus oder derjenigen von Velasquez, gewiss höchster Bewunderung würdige Meisterwerke, wie ebenso der verführerische Reiz von Tizians Kurtisanen-Venus oder gar die alle Erdenwollust verheißende nackte Maya Goyas – ich beanspruche sie alle gleichfalls für einen Augenblick als Preisung nackter Venus-Herrlichkeit –, so unübertroffen liebreizend-schön eine jede davon in ihrer Art sein mag: Von jedweder Verehrungswürdigkeit in einem tieferen, meinetwegen religiösen Sinn sind sie alle miteinander weltenweit entfernt. Bei der Parthenon-Aphrodite dagegen, meine ich, wäre – mag sein, vom im Kunstwerk noch phantastisch gesteigerten – Erlebnis eines großen Künstlers vom ursprünglichen Machtwesen Aphroditens sehr wohl noch etwas nachzuerleben.
Wer die Figuren des Ostgiebels geschaffen hat, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Nach Plutarchs Auskunft hatte wohl Phidias im Auftrag des mit ihm befreundeten Perikles die Oberaufsicht über die Arbeiten auf der Akropolis inne, fest steht, dass er für den Parthenon-Tempel die berühmte Statue der Stadtgöttin Athene aus Gold und Elfenbein angefertigt hat – womöglich würden uns heutzutage solch überaus prächtige, kostspielige Figuren, also auch das ebenfalls von Phidias geschaffene Weltwunder des Zeus von Olympia, weniger beeindrucken als die leider zumeist nur in Bruchstücken erhaltenen Bildwerke der Giebel; ich möchte mir jedenfalls vorstellen, dass die Zweiergruppe von Mutter und Tochter von der Meisterhand Phidias’ stammt, geschaffen etwa um 435 vor Christus.
In beiden Giebeln sind Hauptthemen des Athene-Mythos bildhauerisch behandelt worden, im Westgiebel der Streit zwischen Poseidon und Athene um die Vorherrschaft in Attika, im Ostgiebel die Geburt der Athene aus dem Haupte des Zeus. Interessant zu sehen ist, dass die vergleichsweise gut erhaltene Figur am weitesten links, der nackte Dionysos, vom zentralen Geschehen um Zeus und Athene ebenso abgewendet sitzt wie unsere Doppelfigur auf der rechten Seite: Die martialisch-männertreue Göttin und ihre Vatergeburt scheinen sie nicht allzusehr zu beeindrucken. Homer hatte Dionysos und Aphrodite, wie gehört, an den Rand seiner Götterwelt gedrängt. Hier will es mir fast so vorkommen, als ob zumindest die beiden weiblichen massigen Figuren-Paare die vordringliche Aufmerksamkeit auf sich zögen, vielleicht Resultat einer Berührung des Künstlers mit der unterdes stärker aufgekommenen Mysterienfrömmigkeit, neben dem Mysterien-Gott Dionysos ist ja noch eine zweite Mutter/Tochter-Gruppe mit Demeter und Persephoneia dargestellt, beide hochverehrt in Eleusis.
Doch wie dem auch sei und was genauer die Absicht des Künstlers dabei gewesen sein mag: Vom Gesamteindruck vermögen wir uns wegen der vielen verloren gegangenen Skulpturen keine adäquate Vorstellung mehr zu machen, daher ich mich in meiner Bildbetrachtung und -deutung auf die Mutter Dione und ihre Tochter Aphrodite beschränken möchte. Als Aphrodites Mutter könnte Dione von Homer erfunden worden sein – ihr Mythos findet sonst nur wenig Erwähnung –, um die oben von Hesiod berichtete wüste Geburts-Geschichte vornehm zu retouchieren, was hinwiederum den eher bäurisch-biederen Hesiod geärgert haben könnte, der vorgeblich die Wahrheit ja besser wusste – denn die Musen, deren Wahr-Sagung er sich im eigenen Fall sogleich eingangs seiner „Theogonie“ versichert hatte, die aber ansonsten „vielen Trug … zu sagen … verstehen” (28), sollten ihre Lügengeschichten ja wohl in erster Linie dem Konkurrenten Homer erzählt haben: Das hatte also endlich richtiggestellt werden müssen. Immerhin hatte Homer aber mit Dione laut Genealogie Hesiods eine Tochter des Okeanos zur Mutter Aphrodites ernannt, vielleicht seine verhaltene Entmythisierungs-Version der Meer- und Schaumgeburt der Liebesgöttin. Doch wie dem auch gewesen ist, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ist von Homer auch wieder die Vorlage für unsere Szenerie geliefert worden: „Tochter im Schoß der Mutter“. Eindrucksvoll hatte er nämlich in der „Ilias“ davon erzählt, wie Aphrodite nach ihrer Verletzung durch Diomedes auf den Olymp geflohen war: „Sie sank in den Schoß der Dione, / Ihrer Mutter, und diese umfing mit den Armen die Tochter, / Streichelte sie mit der Hand“ (Il. 5.370 ff.) und redete begütigend, tröstend auf sie ein.
Von einer derartig speziellen Trostsituation kann im Falle des Parthenon-Paares allerdings keine Rede sein, vielmehr ist hier sozusagen die ewig-einige Dyade von Mutter und Tochter Bildgestalt geworden. In Erinnerung an die Kunst des christlichen Abendlands fühlt man sich daraufhin zum Vergleich mit Bildern der „Anna Selbdritt“ herausgefordert, wo ebenfalls eine erwachsene Tochter, allerdings ihrerseits bereits eine „Mutter mit Kind“, auf dem Schoß ihrer eigenen Mutter sitzt, soll heißen: der Großen Mutter, wie ich im ersten Band ausführlich das herausragende Beispiel dieses Genres gedeutet habe, Leonardos Gemälde aus dem Louvre. Doch von einer mütterlichen Aphrodite ist in unserem Fall bezeichnenderweise rein gar nichts zu sehen, dies für das spätere Abendland bedeutungsvollste Thema hat in der griechischen Antike, wie schon erwähnt, kaum Interesse gefunden. Und die Mutter Dione dürfte auch keine geistbestimmte Sophiafigur vergegenwärtigen wollen, sondern kaum etwas anderes bedeuten als eine Verdoppelung des Aphrodite-Wesens: das Ewig-Weibliche, aber in Erdgestalt – dass die Mutter Dione mit ihrer Tochter wie gleichaltrig wirkt, bereitet im Falle der aller Zeit und Vergänglichkeit entzogenen griechischen Götter ja keinerlei Denk-Schwierigkeiten und phantastische Glaubensverrenkungen wie im Christentum.
In wohl nie übertroffener Weise wäre demnach hier nach meinem Urteil der Triumph des Aphrodite-Wesens in menschlicher Doppelgestalt zu erhaben-schönster Darstellung gekommen. Ich halte es für möglich, dass in Ansehung der Gesamtkonzeption eine fortlaufende Betrachtung von der aufgehenden Sonne links zum untergehenden Mond rechts angeregt werden sollte, selbstverständlich mit dem Blickfang der Zentral-Gestalten des hohen Mittags. In Richtung auf die Nachtseite des Lebens hin, über die Licht- und Geistgötter hinweggleitend, hätte dann die – zumindest von den beiden erhalten gebliebenen – bedeutendere Gruppengestalt, die Doppelfigur der Erd-, Lebens- und Liebesgöttin, den Blick des Betrachters angehalten, sich für einen seligen Augenblick lustvoll auszuruhen, entzückt vom Gunst-Bild weiblich vollkommen schönen Erdenlebens.
Damit im Einklang stünde, meine ich, sehr wohl, abgesehen vom Zwang der Giebelschräge, dass die weiblichen Figuren nicht männlich straff zu aktiv-tatbereiten Geistfiguren aufgerichtet sind, sondern sitzend dargestellt wurden, die wichtigste, Aphrodite, sogar halb liegend, ruhend, hineingeschmiegt in den Schoß ihrer Mutter. Liebevoll wird sie vom Arm der Mutter umfangen, fürsorglich, und verlässlich mit Bein und Knie abgestützt. Der Arm der Tochter liegt entspannt auf dem vorgeschobenen Oberschenkel der Mutter, ihr Rücken lehnt bequem am weichen Busen Diones. Entstanden ist so eine wunderbar friedliche Szene, bestimmt vom Zauber zärtlicher Paareinheit und dem gelösten Lebensgenuss der Tochter im Vertrauen auf die mütterlich gewährleistete Geborgenheit, eine Apotheose erotischer Verbundenheit im Aphrodite-Wesen. Und zu gebührender Rühmung solchen Hochbilds schönster aphroditischer Liebenswürdigkeit hat der Künstler ein Liebeswerk der klassischen Kunst zu schaffen gewusst, wo alles Harte, Männlich-Geistige des Dorertums, wie noch in den Figuren des Zeustempels von Olympia, dank Amalgamierung mit dem anmutig-weiblich ionischen Stil in einem der liebwerten Aphrodite-Wesenheit genugtuenden Wunderwerk der attischen Klassik aufgehoben erscheint.
Ohne Frage stellen diese beiden Frauengruppen des Ostgiebels – Demeter und Kore links und Peitho, Dione und Aphrodite rechts von der Mitte, dazu die verloren gegangene Figur der Götterbotin Iris, bemerkenswerterweise eine Mehrzahl weiblicher Figuren –, einen wohl nie übertroffenen Gipfelpunkt des vereinigt dorisch-ionischen Kunstsinns in Körper- wie Gewand-Bildung dar, dank deren genialer Vereinigungsgestalt dem Aphrodite-Wesen neben dessen Lieblichkeit und Liebenswürdigkeit zusätzlich Glanz und Glorie göttlicher Hoheit und Erhabenheit verliehen werden konnte, ohne dass der sinnliche Reiz der Erdenschönheit deswegen im geringsten aufgeopfert erschiene, ganz im Gegenteil. Unbemüht hat sich durch die Gewandung eine gewisse Dezenz bewahren lassen, lange Zeit ist sich ja überhaupt gescheut worden, den göttlich-weiblichen Körper völlig nackt darzubieten, männliche Nacktheit dagegen war längst gang und gäbe gewesen – was immer für Gründe daran schuld gewesen sein mögen. Doch zum Vergleich denke man nur für einen Augenblick an die streng dorische Peplos-Gewandung der Atlas-Athene! Wie anders mutet dagegen hier der übergeworfene Chiton Aphrodites an! Fast will es mir so vorkommen, als hätte sich auch mit Phidias’ attischer Kunst eine streng-steinerne Klassik, wie es zweitausend Jahre später der Renaissance mit dem Barock ergangen ist, sozusagen über sich hinausgesteigert zu Bildwerken einer prangenden Lebensfülle schwellenden Fleisches und phantastisch erhöhter Rhythmik der Bekleidung. Von der aphroditischen Lebensfeuchte erscheint der harte Stein wie aufgeweicht, das Wasser des Lebens, aus dem Aphrodite laut Mythos herrlich zu fest umrissener menschlicher Gestalt entstanden war, scheint wie in Kaskaden die Gewandfalten hinabzugleiten und wie ein durchsichtiger Wasserschleier den Leib zu umfließen, mächtig geteilt zum strömenden Schwall von den felsengleich-widerständigen, stolz aufragenden, unverwelklichen Brüsten; danach durch den Gürtel im Spiel von Wellen- und Schaumgekräusel in der Leibesmitte gesammelt, ehe alles, Hüften und Beine wie mit einer Hülle aus flutenden Wassern umschmeichelnd, zur Erde abfließt: liebreiches Geschenk der zeugend-gebärenden Fruchtbarkeit des ewigen Elements.
Die rechte Schulter Aphroditens ist entblößt, das Gewand etwas hinuntergeglitten, doch niemand müsste befürchten, die starken Brüste würden es nicht halten können, das köstliche Geheimnis des göttlichen Busens würde aufgedeckt werden. Denn wahrlich verdiente diese Aphrodite mit einem Homer nacherfundenen, schmückenden Beiwort „die Schönschultrige“ genannt zu werden. Und wie mächtig wirkt ebenfalls alles Übrige an diesem himmlische Wonnen verheißenden Leib: die Brüste, der Bauch, die Schenkel, alles verschleiert zwar, die reizende Pracht des Körpers nur ein verschwiegenes Versprechen; keine entblößend-nackte, sondern verborgen-verlockende, zwar majestätische, aber einladend-reizvolle, weiche Üppigkeit des Leibes – nur kecker Mut und männliche Kraft eines Ares dürften es wagen, sich dieser in sich ruhenden, sich selbst genügenden und genießenden Überfülle weiblichen Lebens begehrlich, selbstsicher zu nahen, „das flutend strömt gesteigerte Gestalten” (Goethe: Gedichte und Epen I; Paria, S. 366), ewig fruchtbar neues Leben zu gebären verheißend.
Daher erachte ich diese Parthenon-Formationen für eine Art Vollendung griechischer Bildhauerkunst, vermutlich doch durch den zur Meisterschaft seines Altersstils gelangten Phidias geschaffen, der seine Kunst, wie zu ihrer Zeit ein Michelangelo, Leonardo, Rembrand, in Überbietung alles Vorherigen zu etwas unvergleichlich und schlechthin Vollkommenem gesteigert hat. Mit dieser Skulptur des Aphrodite-Wesens war vom bildenden Künstler ein würdiges, allen vom Dichter Homer ererbten Überschwang des männlich-griechischen Geistes in die Schranken weisendes Wunderbild der Göttin „Natur“ geschaffen worden, der Schönsten und in Wahrheit Ruhmwertesten im Kreis der Olympischen, weil die Liebe das Allerschönste und Liebenswürdigste ist, der das Erdenwesen Mensch als dankbares Kind der Göttin des Lebens höchste Achtung und Huldigung schuldet.
Damit hätte jenseits des Verhängnisses für das Abendland, das ihm Homer mit seiner Geistüberschätzung beschert hatte, auch die bildende Kunst, die ansonsten kaum vom durch den Dichter gewiesenen Weg der Rühmung der schönen menschlichen Geist-Gestalt abgewichen ist, zurückgefunden, auf diesem Gipfelpunkt der attischen Klassik, zur Erkenntnis von der Übermacht der Moira noch über alle Geistgötter, zu wissender Bescheidenheit in Ansehung der ehernen Notwendigkeit der Natur, die Aphrodite ihr ewig zuspinnt. Allein durch liebende Annahme des Lebensgeschenks und im weislichen Einverständnis mit seinem Todeslos vermöchte der Mensch der Göttin „Welt“ dankbar zurückzuerstatten, was ihm durch ihre Gunst verschwenderisch vergönnt wurde: „Wie es auch sei das Leben, es ist gut” (Goethe: Gedichte und Epen I; Der Bräutigam, S. 386).
Wie Homer sich solche Verwirklichung eines wahren, sprich: humanen Selbst im Falle des von ihm exemplarisch-vorbildlich gestalteten Leidensweges und Todesschicksals seines Protagonisten Achill vorgestellt hat, das mag sich nun, unsere Beschäftigung dieser arché des geistigen Europas damit abschließend, aus der Schilderung der Hauptetappen von Achills Heldenleben ergeben.