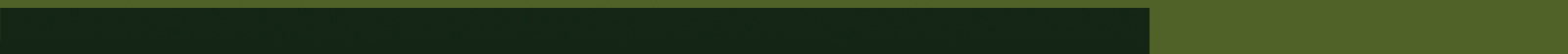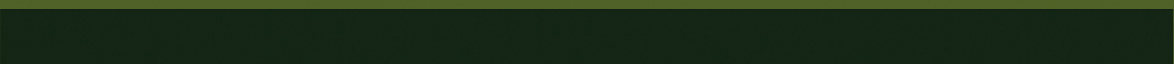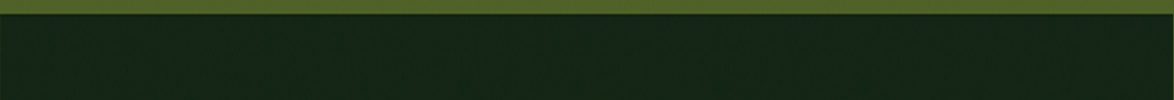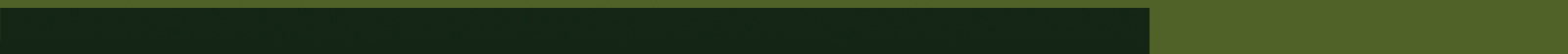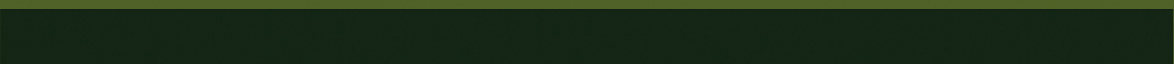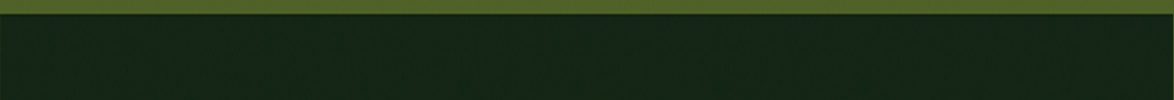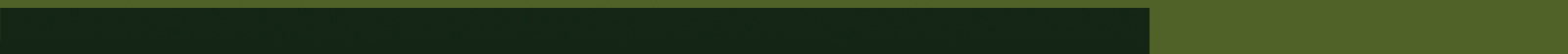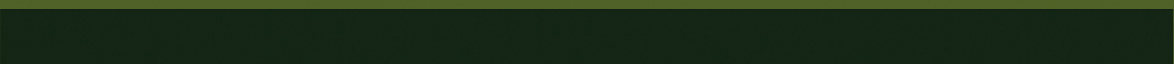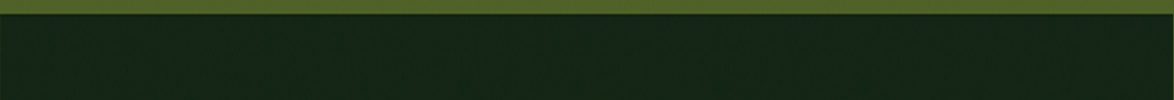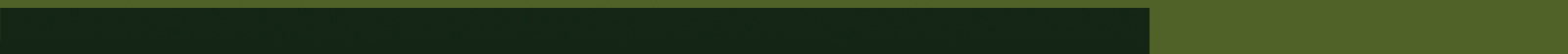
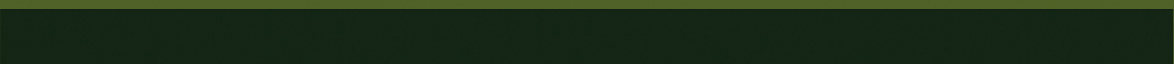
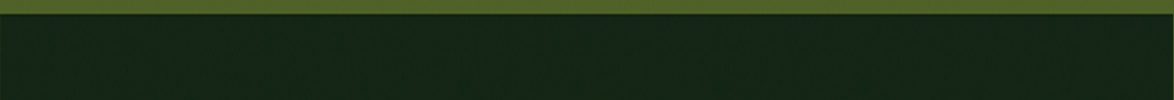
Caesar: Prototyp des Römers.
Den Schiefer-Caesar aus Berlin (Abbildung) möchte ich dazu nutzen, diesem zumindest in Deutschland vertrautesten Bildnis noch ein wenig mehr vom allgemeinen Wesen abzusehen, das „man“ sich von „dem“ Römer geläufigerweise macht. Selbstredend wäre bei „dem“ Römer von vornherein nicht an den Durchschnittsbürger des römischen Reiches oder gar an den reichen Stadtrömer zu denken, der mag schon damals wenig dem idealen Selbstbild oder auch der heutigen Idealvorstellung entsprochen haben und plump und dick und fett gewesen sein. Der Typus des Römers und Welteroberers, den ich im Auge habe, ist der kampferprobt-siegreiche Legionär, kein Gramm zuviel am Leib, schlank, drahtig, zäh, gewandt, durchtrainiert, und dazu beseelt von ungemeinem Selbstbewusstsein und Stolz. Denn als Vorbild zu solchem, seinem Selbstlob verdankten Selbstbild konnte ihm sein berühmtester, erfolgreicher Feldherr dienen, von ebenso hagerer Statur wie er, aber überdies von vornehmer Rasse, altem Adel, unüberbietbarer Selbstherrlichkeit, der hochsinnige Anwalt und Garant von Roms Weltherrschaft und der geborene Führer zu den Siegen dank geistiger Überlegenheit, kurz: Gaius Julius Caesar. Zu werbender Verständigung über das Gemeinte vergleiche man mit den Fotos von Cäsars Antlitz etwa Pompeius’ Biedermannsgesicht; ohne jede Rasse und Klasse; mit aufgestülpter Nase; wie überrascht oder erwischt in seiner nackten Bedeutungslosigkeit; mit hochgezogenen Brauen über verkniffenen Augen; bei dem einzig an der Alexanderlocke die angebliche „magnitudo“ abgelesen werden kann – imaginiert irgendjemand in aller Welt so den „echten“ Römer (vgl. die Abbildungen Meier, S. 166, 184)? 30 Oder etwa so, wie der grimmig-brutal ausschauende Finsterling Crassus aus dem Pariser Louvre sich ausnimmt, dessen Gesichtsausdruck man die sechstausend grausam gekreuzigten Spartacus-Sklaven entlang der Via Appia glaubhaft anzusehen vermeinen könnte (vgl. S. 198)? – ein bedenkenswertes Beispiel für die „anständige“ Bestrafung von Rebellen gegen Roms gottgewollte Herrschaft. Nicht einmal Catos ansprechende Büste aus dem archäologischen Museum in Rabat käme beim Vergleich in Frage, bei der mir bei Annahme des wohl beabsichtigten Eindrucks moralisch-asketischer „dignitas“ von der vitalen Lebensfülle „des“ Römers nur ein dürftig-gnadenloses Raubvogelgesicht übrig geblieben zu sein scheint (vgl. S. 223). Am ehesten käme, meine ich, als Konkurrent Caesars noch Kaiser Augustus in Betracht, doch der ist zu einseitig ewig-jünglingshaft-schön gebildet worden, als dass er gegen die viril-machtvolle Vitalität der Caesarbildnisse ankommen könnte.
Doch wie dem auch sei, schon durch seine erlesene Farbigkeit wirkt die Berliner Caesar-Büste besonders ansehnlich, übertrifft dadurch andere Caesar-Bildnisse eindrucksvoll und hat so vielleicht wirklich das Bild „des“ Römers erheblich mitgeprägt. Das Material, aus dem die Berliner Büste gefertigt wurde, ist grüner Schiefer, wie er in Ägypten gefunden wurde, im Wadi Hamamet. Wahrscheinlich stammt das Bildnis daher ursprünglich tatsächlich aus Ägypten, falls es keine Fälschung ist. In der Tat wurde der Verdacht erhoben, der grüne Kopf stamme aus dem 17. Jahrhundert, und Friedrich der Große, der ihn im 18. Jahrhundert erstanden hat, sei infolgedessen auf eine Fälschung hereingefallen. Angeblich ist jedoch diese besondere Art Schiefer in Europa damals noch gar nicht bekannt gewesen, und auch andere Untersuchungsergebnisse sprechen dafür, dass das außergewöhnliche Werk in Tat und Wahrheit in Ägypten geschaffen worden ist, irgendwann nach Caesars Tod, laut Auskunft Herbigs vielleicht als Kultbild für Kleopatras historisch abgesicherten Caesartempel (vgl. S. 85). Das würde dafür sprechen, dass dem Kunstwerk eine gewisse Authentizität zumindest im Sinne eines In- oder Wunschbildes von Kleopatra zugesprochen werden dürfte, und es ließe sich sogar mutmaßen, auch der preußische Caesar-Verehrer Friedrich habe in der gekauften Büste sein Hochbild von Caesar-Feldherr und Caesar-Führer gesehen und nach diesem Vorbild vielleicht nicht nur sein Selbstbild als Kriegsherr geformt, sondern sich auch sein Bild „des“ Römers geschaffen. Bei der Deutung vertraue ich mich gerne Herbigs allgemeinem Urteil an, dessen Bilderläuterungen mich ansonsten wenig ansprechen, dass der Berliner Caesar den leibhaftigen Caesar „in … subtilster Geistigkeit erfasst“ habe (ebd.). Für die Richtigkeit dieses Urteils spricht, meine ich, schon die zurückhaltende Gestaltung der üblichen Identifikationsmerkmale für die Caesar-Bildnisse: Das wie unabsichtlich nach vorn gekämmte, spärliche Haar, wodurch ungezwungen der schön gewölbte Schädel und die herrlich-hohe Stirn mit nicht gar so ins Auge fallenden Falten bedeutend wirken können; auch weder der lange Hals mit ausgeprägtem Adamsapfel noch das ausgeprägte Kinn fehlen, aber alles erscheint vergleichsweise unaufdringlich gebildet; die Falten neben Nase und Mund sind zwar vorhanden, aber wirken bei weitem nicht so bedrohlich wie die grimmigen Exempel im Pisa-Machtgesicht; die Augen, gefertigt aus marmornen Einlagen, sind groß und weit geöffnet, blicken helläugig, klarsichtig, auch nichts verbergend. Und so möchte ich dieses Caesar-Bildnis überhaupt sehen, nicht als Bild eines willensgewaltigen Imperators wie den Pisa-Kopf, sondern als Gleichnis sublimer Geistmächtigkeit und vornehm überlegener Herrschernatur. Mit der glattpolierten Oberfläche des farbigen Steins wäre diesem noblen Caesar-Genius dann eine adäquat einnehmende äußere Gestalt geschaffen worden.
Das Gesicht ist gezeichnet von klaren, kräftigen Linien, Stirn und Nase, Lippen und Kinn sind edel gebildet und von streng aristokratischer Askese geprägt. Vom steinern-harten, geglätteten Material begünstigt, ergibt sich so ein Eindruck von kompakter, insichruhender Stärke, wodurch das Antlitz eines Siegers beglaubigt wird, eines erfolgverheißenden Römers, der nicht durch brachiale Gewalt, sondern durch die männlich-unbeirrbare Entschiedenheit eines über alle Hindernisse souverän triumphierenden Geistes obsiegt hat – gerne möchte man sich vorstellen, dass der durchdringende Blick aus solch sehenden Augen in dem feinsinnigen, aber männlich-festen Gesicht auch eine jugendschöne Kleopatra hat erobern können, so dass dies für meine Begriffe schönste, sprich, sein Inneres offenbarendste Antlitz Caesars von einer liebenden Frau zur Erinnerung an den geliebten Mann in Auftrag gegeben worden sein könnte: Dem Künstler wäre es somit geglückt, etwas vom wirklichen Wesen Caesars, sicherlich verklärt, aber nachvollziehbar für alle Nachgeborenen aufzubewahren und attraktiv vor Augen zu stellen.
Mit Kleopatra ist nun schon der, wie ich meine, überaus wichtige Name eines Menschen gefallen, dem für die kurze, noch übriggebliebene Lebenszeit Caesars größte Bedeutsamkeit zugemessen werden darf, größere vielleicht als Pompeius und Cato und Pompeius’ Sohn in den letzten und erbitterten Kämpfen in Spanien – auf die ägyptische Königin ist daher noch eingehend zurückzukommen. Die genannten Gegner mitsamt dem Senat standen damals der Anerkennung von Caesars – sagen wir es mit dem ihm wesenseigenen Ausdruck – „dignitas“ hindernd im Wege, wohingegen sie ihm von Kleopatra herrlich bestätigt wurde. Daher mussten sie einer nach dem anderen besiegt und beseitigt werden, das hat Caesar wohl sich selbst schuldig zu sein geglaubt. Aber unversehens war damit das alte Rom abgeschafft worden, und Caesar war nicht als Einer, „primus inter pares“, sondern als Einziger, als „μόνος“, übrig geblieben, als Monokrat, daher ihm nunmehr als Aufgabe zufiel, die Monarchie zu begründen und sich ihre Zukunft auszudenken und diese vorzubereiten – und ich gebe mich der Überzeugung hin, dass auf seine Vorstellungen von Alleinherrschaft die Begegnung mit der orientalischen Königin, der klugen und ambionierten Pharaonin im uralt monarchischen Ägyptenland, einen entscheidenden Einfluss genommen hat.
Nach Vercingetorix’ Niederringung war der Widerstand der Gallier endgültig gebrochen, im achten Kriegsjahr hat es zwar noch kleinere Aufstände gegeben, derer Caesar aber leicht Herr zu werden vermochte – dies letzte Kriegsjahr in Gallien hat er in seinem „Bellum Gallicum“ dann erst gar nicht mehr selbst beschrieben. So wie er es sah, und in dieser Ansicht musste er sich durch das ihm zuletzt vom Senat bewilligte Dankesfest von zwanzig Tagen (vgl. Bellum Gallicum, 7.90) eindeutig bestätigt fühlen, stand nachgerade die verdiente Anerkennung seiner Kriegs-Taten in Rom an, die schuldige Ehrung und Rühmung durchs Vaterland. Er hat das selbst anscheinend, echt altrömisch, familien- und adelsstolzer Aristokrat, der er war, für nichts denn die ihm geschuldete Bestätigung und Belohnung seiner „dignitas“ angesehen und deren verweigerte Anerkenntnis durch die Regierung als Grund dafür angeführt, es sei ihm zuletzt nichts anderes übrig geblieben, als sich an der Spitze seiner Soldaten dies schwererrungene, genugtuende Recht mit Gewalt zu verschaffen – ich wäre bereit, ihm darin Glauben zu schenken. Dazu wäre sich nur zu vergegenwärtigen, dass im Erstreben und Erwerben solcher „dignitas“ – mit einem einzigen deutschen Wort lässt sich dieser höchste Wertbegriff aristokratischen Römertums kaum übersetzen, allenfalls als Inbegriff von Achtung, Anerkennung und Ansehen umschreiben, von zustehender Ehrung und Rühmung dank verdienst- und würdevoller Taten und Werke zu Heil und Segen der Vaterstadt – das Lebensziel eines jeden Römers bestanden hat, der etwas wert war und sich für etwas wert hielt; Sinn und Zweck seines Lebens, aufs innigste zu wünschen und leidenschaftlich zu wollen. Natürlich ist dies gemeinsame Selbsthochbild des römischen Adels, Signum seines eigensten Ethos, allemal auch der Ansporn zu Machtkampf und Selbstbehauptung gewesen, und für Caesar ging es unter den gegebenen Umständen nach „Gallia paccata“ abermals um einen Kampf um alles oder nichts, d. h. um Wahrung seiner Macht und seiner selbst oder um beider Verlust. Denn wenn es ihm nicht gelang, nach seiner Prokonsulzeit in Gallien bruchlos ins Konsulat zu kommen, musste er befürchten, dass er an den neu gewählten Prokonsul nicht nur seine Legionen verlieren, sondern ohne den Rückhalt des Heeres und als Privatmann in Rom von der ihm erklärtermaßen feindlich gesinnten Optimatenpartei, die ihn unter der geistigen Führung Catos sozusagen seit jeher des Anspruchs auf Alleinherrschaft verdächtigt hatte, all seiner Macht verlustig gehen, ja unter Anklage gestellt werden würde. Hinzu kam, dass die Senatspartei in der Person von Pompeius inzwischen einen renommierten Anführer gefunden hatte. Dieser hatte zuvor bereits einmal als alleiniger Konsul amtiert, mithin exakt die Stellung in Rom und Reich innegehabt, nämlich die eines vom Senat beauftragten Diktators, die Caesar wohl von Beginn seines bewussten politischen Lebens angezielt hatte und von der er inzwischen glaubte, sie sich redlich verdient zu haben: die des ersten Mannes im Staat; also wohl noch nicht die uneingeschränkte Alleinherrschaft, wie ihm von Sueton als heißestes Begehren „seit seiner Jugend“ (30) unterstellt worden ist, sondern fürs Erste die einer zeitgebundenen, von Senat und Volk gewährten Herrschaft als Konsul, gegebenenfalls als Diktator, aber noch immer zeitlich begrenzt – erst ganz zum Ende ist er von dieser zeitlichen Befristung abgerückt. Um dies längst gesteckte Ziel zuwege zu bringen, ist Caesar zu weitgehenden Zugeständnissen gegenüber Senat und Pompeius bereit gewesen; anfangs, indem er zu erreichen suchte, dass Pompeius gleich ihm auf seine Provinzen und Legionen Verzicht leistete, wozu er selber sich bedingungslos bereit erklärt hatte; danach mit immer neuen Angeboten, die eigene Machtstellung einzuschränken, ja preiszugeben, so ihm dafür nur das nächste Konsulat bewilligt würde – vergeblich, die Gegenpartei, siegesgewiss mit ihrem „größten Feldherrn aller Zeiten“ im Rücken, zeigte sich unnachgiebig und hat dadurch wohl den Bürgerkrieg provoziert und in erster Linie zu verantworten. Allerdings konnte man zu Recht davon überzeugt sein, Caesar würde sein Begehren, der erste im Staat zu werden, als gewählter Konsul ohne alle Skrupel genauso weiterverfolgen wie vermeintlich auch Pompeius, der zuvor von Cato ebenfalls des Strebens nach Alleinherrschaft verdächtigt worden war. Doch in Pompeius’ Fall – obwohl das Misstrauen ihm gegenüber nie ganz erloschen ist, wie diese schwächlichen Figuren der Optimatenpartei am Ende der Republik überhaupt jeden Außergewöhnlichen aus Neid und Ressentiment des Strebens nach Tyrannei und Despotismus verdächtigt haben – konnte man sich inzwischen sicher sein, ihn der Senatspartei einigermaßen verlässlich inkorporiert zu haben, soweit das bei seinem labilen Charakter überhaupt möglich war. Caesar ist, meine ich, in der Zeit vor Pharsalus und Ägypten also wohl noch nicht auf mehr ausgewesen als auf eine seiner „dignitas“ geschuldete Stellung innerhalb der republikanischen Ordnung. Das vorgegeben anzustrebende Modell dürfte für beide damals Sulla abgegeben haben: Konsul, möglichst alleiniger, gegebenenfalls Diktator, und eine sichere Herrschaft, gestützt aufs Heer, um sie auch in Zukunft behaupten zu können – das Weitere würde sich dann schon finden. Und genauso ist es von Caesar nach Pompeius’ Vertreibung aus Italien ja auch gemacht worden; er hat sich Konsulat und Diktatur verschafft, damit er legitim weiter agieren konnte. Zu Beginn des Bürgerkriegs hat man ihn sich meiner Ansicht nach also noch immer als gläubig aristokratisch-republikanischen Römer vorzustellen: die „exempla maiorum“ in Herz und Kopf; vom leidenschaftlichen Willen nach Macht im Staat befeuert; aber vorerst nur nach der höchsten, nicht nach alleiniger Macht trachtend, kaum anders wie seine Gegenspieler, Pompeius, Cato, Cicero. Was er diesen und allen sonstigen Konkurrenten allerdings voraus gehabt hat – in den langen Jahren in Gallien, wo er alles allein im Kopf hatte und alles nach seinem Kopf gelaufen war, in erprobt-gediegenem Selbstbewußtsein zu selbstsicherer Souveränität ausgebildet –, das war seine ihm zur zweiten Natur gewordene Selbstbestimmung, vielleicht Selbstherrlichkeit, geübt und bewährt aufgrund erfahrener geistiger Überlegenheit, die ihn alle Nöte und Gefahren in zahllosen Kämpfen erfolgreich hatte bewältigen lassen; und die ihn nunmehr auch befähigte, nachdem der andere Erste beseitigt war und er als einziger übrig geblieben war, wozu Pompeius nie und nimmer imstande gewesen wäre, sich innerlich nicht nur von Senat und Republik zu trennen, sondern sich und Rom ohne Senat und Republik zu denken; seine Sache ganz und allein auf sich selbst zu stellen, d. h. das Reich als Monarchie und sich als Monarchen zu schaffen. Ich vertraue daher dem mir in diesem Fall klug und ausgewogen erscheinenden Urteil Ciceros (vgl. Meier, S. 419), Caesar habe den Bürgerkrieg „nicht gewollt, sondern nur nicht gefürchtet“. In seinem, in langen Jahren der Selbsterfahrung und ihn fortlaufend bestätigender Erfolge überwältigend gewachsenen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen lässt sich daher meiner Überzeugung nach auch der tiefere Grund dafür finden, dass er, ein anderer Mensch geworden als sein Vorbild Sulla und sein Nachbild Augustus, gelernt hatte, dass er seinen unersättlichen Machtwillen, nicht anders als diese beiden – diese Lektion hatten alle miteinander begriffen –, allein mit Hilfe des ihm frei zur Verfügung stehenden Heereskörpers erfolgreich ausleben konnte; aber den Bürgerkrieg, als er denn einmal ausgebrochen war, befähigt war, anders als diese beiden, seiner „dignitas“ angemessen, anständig zu führen und siegreich auch zu beenden. Substantiell, wenn auch zuletzt erfolglos, rührte aus dieser Selbstachtung und Selbstsicherheit auch seine viel bewunderte „clementia“ her, mit der er überlegen und großzügig seine Gegner zu behandeln pflegte und für sich zu gewinnen suchte – doch denen ist nichts Besseres eingefallen, als ihn zu ermorden. In Reihen der Senatspartei hat ihm mit einem ähnlichem Bewusstsein von „dignitas“, d. h. Verantwortungsbewusstsein für die Roma aeterna, nur Cato einigermaßen Paroli bieten können, der sich beispielsweise gehörig für die Schonung der römischen Mitbürger eingesetzt hat (vgl. Plutarch; 41); nicht jedoch dessen Parteifreunde und ebenfalls nicht der wohl kaum ohne Grund von Cato eines von ihm zu befürchtenden Sullanismus beargwöhnte Pompeius (vgl. Sueton; 75).
Inzwischen sah es, als Caesar sich entschlossen hatte, den Lohn seines Gewinns fürs Reich, scil. Gallien, mit Gewalt einzufordern, ganz und gar nicht danach aus, als ob dieser Streit um seine Belohnung oder Bestrafung und wer in Rom fortan das Sagen haben würde, von vornherein zu seinen Gunsten entschieden gewesen wäre, so dass es ihm nichts hätte auszumachen brauchen, Pompeius seine zwei ausgeliehenen Legionen wohl versorgt zurückzuschicken, die ihm dann alsbald im Feld gegenüberstanden; oder zu Beginn des Italienfeldzugs gefangen genommene Generäle ehrenvoll an Pompeius auszuliefern, so dass sie ihm beim nächsten Gefecht schon wieder zu schaffen machen konnten (vgl. Plutarch, 34; Sueton; 75) – wie ließe sich all das, frage ich, angemessener verstehen als dadurch, dass sein Verhalten, selbstverständlich auch von der Hoffnung auf eine den Gegner gewinnende Vorgehensweise getragen, von einer enormen, kaum jemals übertroffenen Selbstsicherheit und Siegesgewissheit zeugte – vielleicht sogar von Megalopsychia?
Das berühmte Zitat aus Menander beim Überschreiten des Grenzflusses Rubikon, wodurch der Krieg eröffnet wurde, sollte daher nicht wie gewöhnlich übersetzt werden: „Der Würfel ist gefallen“, sondern: „Der Würfel ist geworfen“ – wie er fallen würde, das hatte sich erst zu zeigen. Denn dass Caesars Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen ihn blind gemacht hätten zu leichtsinniger Unterschätzung des Gegners, der für diesmal beileibe kein undisziplinierter Barbar war, sondern ein zahlenmäßig sogar beträchtlich überlegenes Römerheer unter einem gewiss überdurchschnittlich tüchtigen, vermeintlich sogar dem allergrößten Feldherrn, das lässt sich nach Rekapitulation der Ereignisse nicht wohl aufrecht erhalten. Zwar hatte Pompeius’ Senatsheer sich gezwungen gesehen, nach dem ersten, alle überrumpelnden Vorstoß Caesars – in sechzig Tagen war ganz Italien ohne Blutvergießen in seine Hände gefallen (vgl. Plutarch; 35) – in den Osten auszuweichen, aber dort konnte Pompeius dank seines früher erworbenen immensen Renommees auf gewaltige Ressourcen hoffen und auf alsbaldige siegreiche Rückkehr von dort nach Italien und Rom. Darüber hinaus stand ihm ein weiteres Römerheer in Spanien zur Verfügung, Caesar im Rücken, und er hatte die scheinbar totale Kontrolle über das Mittelmeer in Händen – und doch kam alles anders: Caesars überlegenes Selbst- und Führungsbewusstsein und sein genauso selbstbewusstes und überlegenes Heer vermochten alle entgegenstehenden Schwierigkeiten zu überwinden. Caesar und seine Legionäre haben sich damals als die Übermacht und Notwendigkeit bewiesen, denen nichts und niemand Widerstand zu leisten vermochte, und Caesars intellektuelle Überlegenheit hat sich auch in Ausnutzung der anderen Art Notwendigkeit, des Zufalls, als ebenso überlegen und unwiderstehlich bewährt: „fortuna fortes adiuvat“.
Mithin, sein „Glück“ ist Caesar treu geblieben. Oder wäre es nicht doch angebrachter zu sagen: Caesars Hochsinnigkeit, seine „magnanimitas“ hat ihn über seine republikanischen Gegner hinausgehoben und dem römischen Imperium unter Führung der Caesaren, der Kaiser, eine Zukunft eröffnet, die der Roma aeterna wenigstens noch ein halbes Jahrtausend Bestand und Gedeihen und verhältnismäßigen Frieden geschenkt hat?
Nach der überraschend schnell und leicht gelungenen Vertreibung von Pompeius mitsamt Senat und Heer aus Italien in den Monaten Januar bis März 49 und nach erfolgter Preisgabe der Hauptstadt und ganz Italiens durch die Senatspartei,31 was als Symbol zugunsten Caesars gar nicht hoch genug einzuschätzen ist, hat er sich zunächst in Spanien den Rücken gegen die dort stationierten Pompeius-Truppen freikämpfen müssen. Gelungen ist ihm das bis August 49, in aussichtsloser Lage haben die spanischen republikanischen Truppen nach kleineren Zusammenstößen bei Ilerda kapituliert. Um Caesars menschliche Größe oder meinetwegen auch berechnende Großzügigkeit, zumindest Selbstsicherheit – im Ergebnis kommt das allemal aufs selbe hinaus – von der schwächlichen Kleinmütigkeit des Gegners abzuheben, genügt es, nochmals die kleine Begebenheit zu erwähnen, die sich bei Sueton berichtet findet – mag die story nun authentisch sein oder nur gut erfunden –, um die unerwartet und imponierend neuartige Vorgehensweise Caesars zu charakterisieren, seine, wie Sueton sich ausgedrückt hat, „bewunderungswürdige Mäßigung und Milde“ (75): „Als bei Ilerda Übergabeverhandlungen angebahnt worden waren und zwischen den beiden Parteien ein lebhafter freundlicher Verkehr und Handel begonnen hatte, ließen Afranius und Petreius (die Legaten des Pompeius, d. Verf.), die plötzlich ihren Entschluss bereuten, alle in ihrem Lager befindlichen Caesarianer niedermachen; da duldete er es nicht, daß dieser an ihm begangene Treuebruch von den Seinen mit Gleichem vergolten wurde“ (ebd.).
Danach konnte es an die Verfolgung von Pompeius gehen und dieser endlich bei Pharsalus gestellt werden. Allerdings ist Caesars grandiosem Sieg dabei die gemeine Unzulänglichkeit der Optimaten zugute gekommen, die Pompeius, der mit seinen zahlenmäßig überlegenen und gut versorgten Streitkräften Caesar lieber hinhalten, vor sich hertreiben und durch Ermattung und Hunger zur Kapitulation zwingen wollte, geradezu genötigt hatten, die Entscheidungsschlacht anzunehmen; in überheblicher Erwartung des sicheren Sieges über einen nach Dyrrhachium vermeintlich bereits angeschlagenen Gegner, aber auch aus Neid und Rachsucht, aus Ruhmsucht und der Gier danach, Caesars Erbe anzutreten – das Ergebnis, Pharsalus, ist bekannt.
Der geschlagene Pompeius, vor den Trümmern seines Lebens stehend, wohl ein gebrochener Mann, hat sich auf schmählicher Flucht vor dem Sieger um Hilfe nach Ägypten gewandt. Caesar war ihm sogleich gefolgt, kam aber zu spät dort an, man kredenzte ihm den Kopf des schimpflich Ermordeten zur Begrüßung und zu vermeintlicher Einvernahme – auf die danach folgende Begegnung und Liaison mit Kleopatra ist zurückkommen. Gelegentlich von Pompeius’ Verfolgung ist von Sueton ein neuerliches Beispiel für Caesars „Unerschrockenheit“ zum Besten gegeben worden, man könnte auch sagen, für seine Unverfrorenheit, für seine dreiste, siegessichere, selbstherrliche, aber auch geistesgegenwärtige, einfach unwiderstehliche Souveränität: „Nach der Schlacht bei Pharsalus schickte er seine Truppen nach Asien voraus, überquerte selbst den Hellespont auf einem kleinen Handelsschiff, und als ihm Lucius Cassius von der Gegenpartei mit zehn Kriegsschiffen entgegenkam, floh er nicht, sondern fuhr näher heran, forderte ihn als erster zur Übergabe auf und nahm ihn, als er sich ergab, an Bord“ (63).
Nach Pharsalus folgten noch drei Jahre weiterer Kriege auf drei Kontinenten: 47, sozusagen im Vorbeigehen auf dem Rückweg von Ägypten nach Rom – von ihm kommentiert mit dem unvergleichlichen: „veni, vidi, vici“ –, in Kleinasien gegen Pharnakes von Pontus; 46 gegen Cato und die Republikaner im nordafrikanischen Thapsus und 45 gegen die Pompeius-Söhne bei Munda in Spanien, Caesars letzte Schlacht, die nochmals seinen totalen persönlichen Einsatz gefordert hat, unter „tödlicher Gefahr“ für ihn (Plutarch; 56): „Als Caesar sah, wie seine Truppen zurückgedrängt wurden und ihre Gegenwehr erlahmte, lief er durch die Reihen der Kämpfenden und schrie ihnen zu, ob sie sich nicht schämten, ihn solchen Knaben in die Hände zu liefern. Es kostete ihn schwere Mühe und tapfersten Einsatz, bis er endlich die Feinde zurückwerfen konnte“ (ebd.).
Danach hat er sich zum „Diktator auf Lebenszeit“ (Plutarch; 57) ernennen und zu einem anbefohlenen Triumphzug als Sieger über seine Landsleute feiern lassen, was er bis dahin strikt vermieden hatte (vgl. 56), von Plutarch ist beides streng gerügt worden. Im ersten Fall sprach er von „unverhüllter Tyrannei“ (57), und im zweiten hat er Caesar zynischer Überheblichkeit und nachlassender Lebenskraft und Strenge sich selbst gegenüber geziehen, der Missachtung von Göttern, Volk und Vaterland. Dieses Urteil mag auch Shakespeare zu seinem schwächlichen Bild Caesars vor seiner Ermordung verleitet haben, das ja hauptsächlich von Plutarch beeinflußt gewesen ist. Sein abschließendes Urteil über Caesar hat dieser wohl zu einer letzten Ehrenrettung der Republik im Sinne von Pompeius und Augustus zu nutzen versucht: „Daß er (Julius Caesar, d. Verf.) sich den Triumph auch nach diesem Feldzug (dem zweiten spanischen, d. Verf.) nicht versagte, empfanden die Römer als bitterste Kränkung. Er hatte ja nicht fremdländische Heerführer oder Barbarenkönige bezwungen, sondern Söhne und Geschlecht desjenigen Römers ausgerottet, welcher der beste seines Volkes gewesen war und die Tücke des Schicksals erfahren hatte. Es zeugte von wenig Edelmut, daß er jetzt über das Unglück des Vaterlandes triumphierte und sich mit Taten brüstete, für die es vor Göttern und Menschen nur eine Rechtfertigung gab: daß die Not ihn dazu gezwungen! Auch hatte er während des Bürgerkriegs nie einen offiziellen Boten oder Brief nach Rom gesandt, um einen Sieg zu verkünden, sondern solchen Ruhm mit feinem Taktgefühl von sich gewiesen“ (56).
Nach Sueton, so darf dessen Urteil wohl zusammengefasst werden, ist Caesar wegen Missbrauchs der Herrschaft „mit Recht umgebracht worden“ (76). Und Plutarch hat „keinen Zweifler daran rütteln“ lassen wollen, dass eine „göttliche Macht“ Caesar zur Strafe für seine Hybris vor das Pompeius-Standbild verbracht hat, um ihn dortselbst zur Versöhnung der ob der Missetaten des Tyrannen erzürnten Götter sozusagen als Schlachtopfer darzubringen (vgl. 66) – nur hat es offenbar nichts genutzt. Denn nach Caesars Tod folgte ein weiterer, fünfzehn Jahre andauernder und noch sehr viel blutigerer Bürgerkrieg, genauso wie es Caesar für den Fall seiner Ermordung vorausgesagt hatte (vgl. Sueton; 86).
Als erstes wird man sich fragen müssen, um zu einem eigenen Urteil zu kommen, wie die über einige Jahre sich hinziehenden Kriege und Siege über die Republikaner sachlich zu werten wären, noch abgesehen von der Frage, auf welcher Seite das größere Recht war, also vorerst dahingestellt sein lassend, ob Caesars Beschuldigung der Gegenseite nach Pharsalus: „Das haben sie gewollt, dazu haben sie mich gezwungen“ (Plutarch; 46), ohne weiteres nachvollziehbar erscheint; ob dies Niederringen der Republikaner als eine zukunftseröffnende Großtat Caesars zu würdigen wäre; oder zumindest darauf hinwiese, dass einem seine vitale Energie, seine Willens- und Tatkraft zur Behauptung der ihm nach Pharsalus zugefallenen Alleinherrschaft, wollte er nicht alles wieder verlieren, keineswegs als geschwächt vorkommen müssten. Dass er sich 46, nach Thapsus, zunächst für zehn Jahre, 44 dann auf Lebenszeit als Diktator legitimieren ließ, scheint mir dafür zu sprechen, dass er zumindest dem Namen nach und in der Hauptstadt die altehrwürdigen Bahnen des republikanischen Staates nicht ostentativ verlassen hat; allerdings hat er mit diesen Maßnahmen auch an seinem nunmehrigen Anspruch auf Alleinherrschaft keinerlei Zweifel aufkommen lassen und wohl auch nicht daran, dass er sich die Kraft zur Gestaltung der Zukunft nach seinen Vorstellungen und seinem Willen noch zugetraut hat.
Wie jedoch diese Alleinherrschaft in der Zukunft, die es dann für ihn ja nicht mehr gegeben hat, beschaffen sein, d. h. welch dauerhafte Gestalt die immer deutlicher werdende Identifikation seiner selbst mit Rom und Reich annehmen sollte, das dürfte eine der schwierigst, wenn nicht unmöglich zu beantwortenden Fragen beim Versuch sein, zu einem Gesamturteil über Caesar zu kommen, weil in diesem Zusammenhang auch die Werte-Fragen von Caesars Größe und Ethos zu klären und zu beantworten wären; folglich driften die Ansichten hier weit auseinander.
Dass aber für ihn mit der Aufgabe, sich selbst als Alleinherrscher zu definieren, zugleich die andere aufs engste verbunden gewesen ist, eine Neuordnung des Reiches zu überdenken und in Angriff zu nehmen, das möchte ich wohl behaupten. Inzischen ist ihm zur Bewältigung dieser Riesenaufgabe keine Zeit vergönnt gewesen; dass er sie nicht vollbracht hat, kann ihm daher nicht gut als Schuld und Versagen angerechnet werden; das Maß seines Lebensglücks war ausgeschöpft. Nach Pharsalus sind ihm kaum noch vier Jahre Lebenszeit geblieben, für Rom, alles in allem genommen, nicht einmal mehr ein einziges Jahr. Was er gleichwohl in dieser kurzen Spanne Zeit geleistet hat, erscheint unglaublich und aller Bewunderung wert; die bereits in Angriff genommenen, aber nicht mehr ausgeführten Pläne kommen mir geradezu ungeheuerlich vor; und ich bin davon überzeugt, dass das allermeiste, was Augustus in fünfundvierzigjähriger Regierungszeit dann im zweiten Anlauf glücklich vollenden konnte, sich weitgehend Caesars Geist und Tat verdankte. Und nach Augustus hat sich auch nicht dessen Prinzipat im Reich durchgesetzt, sondern Caesars Idee der Monarchie, das Kaiser=tum, das völlig zu Recht seinen Namen trug und diesen weit über das Ende der römischen Caesaren hinaus behalten hat.
Worin wären denn aber Caesars Verdienste zu erblicken? Da muss, meine ich, als erstes genannt und positiv bewertet werden, dass er, zuletzt radikal, abgeräumt hat, was sich überlebt hatte; was länger als ein halbes Jahrtausend getaugt und die bewunderungswürdige Ordnung des römischen Reiches ausgemacht hatte, aber nun falsch und kraftlos geworden war. Das zustande gebrachte Riesenreich war so nicht länger in Form zu halten, der republikanische Staat an sein Ende gekommen. Nachgerade brauchte es jemanden, der genügend selbstbewusst und fähig dazu war, autonom, sich über die sakrosankte republikanische Senatsherrschaft hinwegzusetzen und eine neue Ordnung zu wagen und zu schaffen, ohne dass der Herrschaftsanspruch Roms dabei im geringsten geschmälert worden wäre und er selbst sich nicht länger als „wahren“ Römer hätte fühlen können. Caesar hat den Senat, oder wohl genauer die Senatoren verachtet, und ich meine, er hatte volles Recht dazu. Die republikanischen Werte, die Rom groß gemacht hatten, waren verbraucht; der „populus Romanus“ zur unregierbaren „plebs“ entartet; die aristokratische Elite in voller Zersetzung begriffen; und die Senatsherrschaft hatte sich als unfähig bewiesen, der anarchischen Verhältnisse in Rom während der fünfziger Jahre Herr zu werden, zu Zeiten von Caesars Abwesenheit in Gallien; sie hatte sich als strukturell unvermögend zur Regierung des ins Große gewachsenen Imperiums erwiesen. In Rom wie in den Provinzen regierte längst das Geld und hatte die unersättliche Gier der Einzelnen nach Macht und Reichtum entfesselt, die nicht länger durch staatliche Disziplin und das solidarisch-gemeinsame Interesse der Angehörigen der führenden Schicht am Gedeihen des Ganzen in anständigen Grenzen gehalten wurde. Von der schäbigen Niederträchtigkeit der senatorischen Elite vor Pharsalus in der Gefolgschaft von Pompeius sowie der selbstgefälligen Eitelkeit und Prunksucht der jeunesse dorée lässt sich ein kleiner Eindruck mit Hilfe von Plutarchs Schilderung gewinnen: Im Lager des Pompeius, hat dieser vermeldet, habe man „voll dreister Hoffnung schon zum voraus den Sieg“ ausgekostet. „Domitius, Spinther und Scipio (alle drei ehemalige Konsuln, d. Verf.) stritten um Caesars Priesterwürde und suchten sie sich gegenseitig abzujagen, manch andere schickten Leute nach Rom, um Häuser, die sich für Konsuln und Praetoren eigneten, mieten oder beschlagnahmen zu lassen, da sie gleich nach dem Krieg diese Ämter zu übernehmen gedachten. Am meisten aber brannten die Ritter auf den Kampf, glänzend angetan mit funkelnder Rüstung, voller Einbildung auf ihre wohlgenährten Pferde und ihre schöne Gestalt, nicht zuletzt auch auf ihre Anzahl, standen sie doch siebentausend Mann stark Caesars tausend Reitern gegenüber“ (42).
Aber Caesar hat sie, erbarmungslos ihre Schwächen ausnutzend, das Fürchten gelehrt: Im Vertrauen auf die Wucht ihrer Überzahl, mit der sie Caesars Fußsoldaten in Grund und Boden zu reiten gedachten, kamen die Reiterschwadrone „hochgemut“, wie der Plutarchübersetzer schreibt, aber gemeint ist wohl eher oder jedenfalls auch übermütig und überheblich, zum Angriff herangeritten. „Aber ehe sie noch zum Einhauen kamen, stürmten Caesars Kohorten hervor. Sie schleuderten jedoch ihre Wurfspieße nicht, wie sie sonst taten, stießen auch nicht gegen die Schenkel und Schienbeine der Gegner, sondern zielten nach ihren Augen und verwundeten sie im Gesicht. Caesar hatte ihnen hiezu Befehl gegeben, weil er erwartete, daß die jungen, an Krieg und Wunden kaum gewöhnten, dafür hoffärtig mit ihrer Jugendschönheit prunkenden Männer vor solchen Hieben am meisten zurückscheuen und aus Angst vor der Gefahr des Augenblicks wie vor der späteren Entstellung nicht standhalten würden. Er hatte richtig gerechnet. Vor den erhobenen Spießen sank ihr Mut in nichts zusammen, sie konnten das Eisen nicht vor den Augen sehen, sondern wendeten sich ab und hielten die Hände vor das Gesicht, um es zu schützen. So brachten sie Verwirrung in die eigenen Reihen und jagten schließlich in schmählicher Flucht davon“ (45).
Und all diesen Leuten hat Caesar nach dem Sieg weitestgehend Amnestie gewährt (vgl. Plutarch; 46), auch natürlich, weil er sie zur Regierung des Reiches gar nicht entbehren konnte. Sueton hat resümiert, dass er „gegen Ende seines Lebens allen, denen er noch nicht ausdrücklich verziehen hatte, (erlaubte), nach Italien zurückzukehren und Ämter und Kommandos zu übernehmen“ (75) – schlecht haben sie es ihm gedankt. Caesar dagegen besaß einen klaren Blick für das, was unvermeidlich war, wenn der Staat Bestand haben sollte. Doch dadurch zeichnete sich am Horizont die völlige Entmachtung der Aristokratie ab, und das hat sie in die erbitterte Opposition gegen den Tyrannen getrieben: Denn ein Alleinherrscher, wie immer er sich nennen mochte oder sich großzügig gab, konnte schlechterdings nicht anders, als bedingungslosen Gehorsam seinem Willen gegenüber zu verlangen, also Untertanengeist, und genau diesen verbot den Aristokraten ihr Stolz im Namen der Freiheit, d. h. ihres eigenen Machtwillens. Indes war mit einer derart dezimierten und degenerierten Elite, wie es sie zu dieser Zeit gab, sowie den zu kompetenter Verwaltung des Riesenreichs völlig unzulänglichen Institutionen wahrlich kein Staat mehr zu machen. Mit einiger Verzweiflung ist von Livius im Vorwort zu seiner Rom-Geschichte die gegebene Großwetterlage vortrefflich gekennzeichnet worden: Rom leide inzwischen „an seiner Größe“ und sei „zu den Zeiten“ gekommen, in denen wir weder unsere Fehler noch ihre Heilmittel ertragen können“ (Einleitung, S. 9 f.).
Daher haben es die Römer, auch die besten, später Augustus überschwänglich gedankt, dass er das Rezept für eine Monarchie gefunden hatte, die sich möglichst noch vor sich selber verbarg, aber Idee und Grundlegung jedenfalls Caesar verdankte und dem Reich wie den vielen Völkern, die unter der Herrschaft Roms als Untertanen darin lebten, einen vergleichsweise dauerhaften Frieden beschert und das spätere Aufblühen der europäischen romanischen Nationen ermöglicht hat – natürlich ist das im Endeffekt das unsterbliche Verdient von Augustus selbst gewesen, aber ohne Caesars Vorgang und Vorbereitung hätte die segensreiche „pax Romana“ unmöglich zustande kommen können. Caesar vorzuwerfen, er habe als Staatsmann versagt, halte ich infolgedessen für unstatthaft. In der kurzen Zeit, die ihm verblieb, ist er rastlos tätig gewesen und hat Schritt für Schritt die Richtung auf die neue Ordnung vorgegeben, ohne dass ihm selber der große Wurf noch vergönnt gewesen wäre. Vielleicht wäre das aber selbst von diesem Übermenschen zu viel verlangt gewesen, ohnedies hat die Ermordung seinen Vorhaben, welche immer es gewesen sind, ein jähes Ende bereitet.
Man erinnere sich nur der verzweifelten Lage, in der Rom sich damals seit den schlimmen Zeiten Sullas befand! Zuerst hatte es den furchtbaren Bürgerkrieg zwischen Sullas Optimaten und Marius’ Popularenpartei gegeben, danach die entsetzlichen Säuberungen durch die Proskriptionen Sullas nach dessen Sieg, und beides hatte für die herrschende Klasse einen unersetzbaren Aderlaß bedeutet. Seit diesen schrecklichen Zeiten konnte man mit Geld längst alles kaufen, die Wahlen, die Richter, die Legionen. Korruption grassierte sowohl in Rom, wo nach wie vor von der städtischen Plebs die Administration für das gesamte Reich gewählt wurde, aber unter den Bedingungen von übelster Wahlagitation und massenhaftem Stimmenkauf, als auch in den Provinzen, wo die Legitimation für deren Ausplünderung durch die Prokonsuln vornehmlich darin bestand, dass diese zuvor in Rom dank fragwürdigster Machenschaften zu Konsuln gewählt worden waren. Von Amts wegen hatten sie in dieser Einjahresstellung dem allgemeinen Ganzen zu dienen und konnten sich folglich nur im Kriegsfall bereichern. War ihnen letzteres nicht zu voller Befriedigung gelungen, pflegten sie es in der nachfolgenden Verwaltungstätigkeit in den Provinzen, ausstaffiert mit enormen Vollmachten, gründlich nachzuholen – den verschwenderischen Luxus, den die reichen Besitzenden in Rom trieben, kann man sich kaum üppig und nichtsnutzig genug vorstellen. Nach Sulla war es dann in der Stadt zu den Wirren und Gewalttätigkeiten der Catilinarier gekommen, schließlich beherrschten die Bandenkämpfe zwischen Optimaten und Popularen unter Führung der fürchterlichen Clodius und Milo die Szene, mit alltäglichen Straßenschlachten des Mobs, blutigen Gemetzeln, Morden, Plünderungen, Brandschatzungen, ohne dass der Senat erfolgreich dagegen hätte einschreiten können.
Erste unverzichtbare Schritte Caesars in Richtung Normalität und Befriedung von Stadt und Reich bestanden daher darin, die eingerissene politische Unordnung zu unterbinden. Wenn von Sueton ein Ausspruch Caesars überliefert worden ist, den dieser – oder zumindest sein Übersetzer – simpel als Zeugnis seiner „Unbeherrschtheit“ ausgegeben hat: „Ein Nichts sei der Staat (res publica), ein Wort substanzlos und ohne Gestalt“ (Sueton; 77), so sollte entschieden dem Missverständnis gewehrt werden, damit sei von Caesar als selbstherrrlichem Despot generell seine Geringschätzung, ja Verachtung des Staates zum Ausdruck gebracht worden, nicht bloß diejenige für den republikanischen Staat, genauer für den republikanischen Staat in der Verfallsform seiner Tage; und genauso hat er auf die staatstragende Disziplin und die Führungsqualitäten der Aristokratie, die er von sich selbst verlangt hat und die Rom groß gemacht hatten, keineswegs verzichtet. Meiner Ansicht nach ist er, und vielleicht sogar bis zuletzt, ein aristokratischer Römer reinsten Blutes und unerschütterlicher Gesinnung geblieben, dem die „res publica“ als höchstes Gut gegolten hat, mag er diese auch immer weniger von seiner eigenen Person zu unterscheiden vermocht haben. Am Ende drohte er zum Denkmal seiner selbst zu werden, wie seine äußerste Gefährdung zufolge trotziger Überheblichkeit und Selbstherrlichkeit von Shakespeare tiefsinnig erfasst worden ist.
Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie hart sein Regime, und doch auch wieder nach Möglichkeit schonungsvoll, bei seinen Versuchen gewesen ist, erneut Ordnung im Reich zu schaffen, ist vielleicht am besten mit seinem Verhalten seinen Soldaten gegenüber zu beginnen anlässlich einer Meuterei, die ausbrach, als nach dem ersten Feldzug in Spanien im Jahre 49 und vor dem anstehenden im nächsten Jahr gegen Pompeius die erschöpften Legionäre, die wegen Caesars Großzügigkeit gegenüber den besiegten Landsleuten ohne Beute geblieben waren und die versprochenen Belohnungen nach Beendigung des Krieges auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben befürchten mussten, ihm aufsässig den Gehorsam verweigerten. Kalt ist ihnen daraufhin von Caesar erklärt worden, nach altem Brauch werde er jeden Zehnten der meuternden Legion mit dem Tode bestrafen und den Rest nach Hause schicken – das hatten sie nicht erwartet. Reumütig hätten sie ihn gebeten, sie nicht ehrlos zu entlassen und sie wieder in seine Dienste zu nehmen. Schließlich habe Caesar sie auch in Gnaden wieder aufgenommen, in Wahrheit hatte er sie natürlich dringend nötig. Aber unerbittlich soll er immerhin zwölf der Rädelsführer haben hinrichten lassen (vgl. Sueton; 69 f.). Eduard Meyer hat verzeichnet, bei Soldatenunruhen in Rom habe er einen der Rädelsführer eigenhändig gepackt und dem Henker übergeben. Zwei andere seien nach sakralem Brauch von Priestern öffentlich geschlachtet, ihre abgeschlagenen Köpfe am Hause des Pontifex Maximus, also Caesars Haus, aufgesteckt und zur Schau gestellt worden. Meyer kommentiert: „Die Zeremonie war als Sühneritus gedacht; als Wiederbelebung und Steigerung alter abergläubischer Bräuche … und erscheint umso häßlicher, da Caesar in Wirklichkeit aller Religion völlig kühl gegenüberstand und sie nur als ein Werkzeug für politische Zwecke betrachtete“ (S. 416). Im Grunde dürfte dies Urteil zutreffend sein, doch sollte dabei berücksichtigt werden, dass ihm als „politische Zwecke“ – genauso wie im Falle der grausamen Disziplinierungsmaßnahmen bei den Meutereien und untrennbar von den persönlich-selbstischen Selbstbehauptungszwecken des Menschen Caesar – natürlich auch die bewährt erfolgversprechend-sakralen zum Heil der Roma aeterna – für ihn selber bestimmt völlig ununterscheidbar – gegolten haben – wie Roms Selbstbehauptungszwecke unter ethischen Gesichtspunkten zu beurteilen wären, steht natürlich noch auf einem anderen Blatt, dazu werde ich später, mich zu äußern, noch Gelegenheit nehmen. Wenn Caesar daher gelegentlich einmal geäußert haben soll, „die Ruhe Italiens, der Friede der Provinzen und das Heil des Reiches“ (zit. Heuss, Römische Geschichte, S. 210 f.), mithin die Wohlfahrt des Ganzen müsste das ewig vorgegebene Ziel aller politischen Bemühungen des Römischen Staates sein, so steht für mich jedenfalls außer Frage, dass sich die republikanische Senatsherrschaft während des letzten Jahrhunderts zur Verwirklichung dieser staatserhaltenden Zwecke als notorisch unfähig erwiesen hatte; und dass Caesar sich nach Beendigung des Bürgerkriegs der notwendigen Lösung der anstehenden Probleme unter vollem Einsatz seiner Intelligenz und Tatkraft und im Einklang mit seinen tiefverwurzelten Überzeugungen vom ewigen Rom mit aller Leidenschaft und auch erfolgreich angenommen hat. Durchweg ist das auch von meinen Gewährsleuten anerkannt worden, und dem wohl bedeutendsten Römer in diesen letzten Lebensjahren staatsmännische Größe abzuerkennen, bin jedenfalls ich nicht bereit. Eduard Meyer hat „von der staunenswerten Tätigkeit und Energie, die Caesar in den wenigen Monaten seiner Herrschaft entfaltet hat“, gesprochen, und dieses Urteil durch den für meine weiteren Überlegungen wichtigen Zusatz ergänzt: Das „widerlegt so gründlich wie möglich den Vorwurf, daß seine Kräfte oder die Klarheit seines Geistes getrübt gewesen seien“ (S. 504); und ebenfalls von Heuss ist Caesars „überdimensionale Energie“ (Propyläen, S. 289) gerühmt worden, die sich zumal in Verwaltung und Gesetzgebung entfaltet habe. Treffend lässt sich der persönliche Stil von Caesars politischem Handeln wohl mit den beiden Worten Suetons hinsichtlich der Behandlung seiner Soldaten kennzeichnen: „Strenge wie Nachsicht“ (65); allgemeiner ausgedrückt: Notwendige Härte bei größtmöglicher Schonung. Doch damit hätte Caesar im Grunde nur der von jedem anständigen Römer geforderten Gesinnung Genüge getan und Roms altehrwürdigem und bewährtem Ethos seine Reverenz erwiesen: der autoritär-patriotischen Handlungsweise des römischen Familienvaters wie des aristokratischen Patrons gegenüber seinen Klienten. Und, wie oben schon auseinandergesetzt, dürfte das auch genau Caesars allgemeine Einstellung zu seinen Soldaten gewesen sein, die ihm deren Ergebenheit und Dienstwilligkeit eingebracht hat, genau besehen also bereits den Untertanengeist, den er als Monarch von allen verlangen musste, der ihm aber aus Tradition und Eigendünkel von seinen Standesgenossen partout verweigert wurde. Wie er es bei der Eroberung Galliens als selbstherrlich-patrizischer Römer und treuer Patron der für Rom und Reich Hinzugewonnenen und nunmehr als Roms Untertanen Geltenden erfolgreich gehandhabt hatte, so ist er auch weiterhin bemüht gewesen, als einziger Patriarch und Patron im legitimen Status und Amt eines Konsuls das Regiment in Stadt und Reich auszuüben: Zunächst, 45, als Konsul ohne Kollegen; dann als Diktator auf ein Jahr; dann, im Jahre 46, als Diktator für zehn Jahre; dann als „dictator designatus perpetuo“, als Diktator auf unbefristete Zeit; und erst in seinem Todesjahr als Diktator auf Lebenszeit („dictator perpetuo“). Das Letzere hat ihn in den Augen der Republikaner dann wohl endgültig ins Unrecht gesetzt und zum Usurpator und Tyrannen gestempelt, angemaßter Kandidat des verhaßten Königtums. Aber Caesar hatte sich doch wirklich alle Mühe gegeben, Selbstverständnis und Selbstwertgefühl der römischen „res publica“ zumindest dem Namen nach zu schonen: Einen Diktator in irgendwie eingeschränkter, zumal zeitlich eingeschränkter Funktion hatte es in Rom angeblich ja seit fast einem halben Jahrtausend gegeben, daher man sich die Diktatur damals noch als eine Art Prinzipat zurechtlegen und sich der Hoffnung hingeben konnte, diesen gegebenenfalls wieder aufkündigen. Diese Möglichkeit auszuschließen, hat Caesar danach vielleicht zum definitivem „auf Lebenszeit“ bewogen, da er damals für einige Jahre auf dem Partherfeldzug von Rom abwesend zu sein gedachte und dort keinerlei Missverständnisse aufkommen lassen wollte. Dass aber diese Politik Caesars, die natürlich nicht verschleiern konnte, dass alle Macht monokratisch in seiner Hand lag, von den Aristokraten nicht als die eines „wahren“ Römers anerkannt werden konnte, lag wohl nicht nur nicht nur an deren „Freiheitswillen“, sprich an ihrem eigenen Machtwillen und an ihrer Habgier, sondern auch daran, dass es Caesar nicht gelungen ist, worin vielleicht die größte Gefährdung des Megalopsychos besteht, weder seiner Überheblichkeit aufgrund maßloser Überlegenheit zu wehren, noch die Verachtung auch nur verhehlen zu wollen, die er wohl allen gegenüber hegte, die seinen eigenen hohen Standards vom „wahren“ Römer nicht entsprachen. Und darüber hinaus sind die altvertrauten Institutionen pietäts- und rücksichtslos von ihm aus dem Weg geräumt worden, wo immer sie ihm zur Neuordnung des Reiches nicht länger tauglich erschienen, was viel böses Blut gemacht hat. Also, was hat Caesar erstrebt, was hat er erreicht zu Heil und Wohl von Stadt und Reich in der kurzen Zeit, die ihm noch zur Verfügung gestanden hat, und wie wäre das zu werten und zu würdigen?
Das drängendste und zunächst wichtigste Problem, das zur Lösung anstand, war natürlich die Armee und die Versorgung der Veteranen. Wie umstandslos und erfolgreich ein Umsturz der bestehenden Ordnung durch die Macht der Waffen bewerkstelligt werden konnte, hatte Caesar selber ja soeben erst vorexerziert, einschränkungslos standen auch nach Beendigung des Bürgerkriegs alle Legionen im Reich unter seinem Oberkommando. Um eine Machtkumulierung in den Provinzen durch die sie verwaltenden Prokonsuln und Praetoren zu unterbinden, erließ er vorsorglich ein Gesetz, das ihre Amtstätigkeit auf zwei bzw. ein Jahr beschränkte – gebracht hat auch das nichts, per Volksbeschluss ist bereits von Antonius dies gut gemeinte Verbot leichtfüßig wieder unterlaufen worden. Das heikle Problem der Veteranenversorgung, mit der er aber reichlich Erfahrung bei der erfolgreichen Unterstützung von Pompeius gesammelt hatte, der sich damals gegen die törichten und selbstsüchtigen Widerstände des Senats nicht hatte durchsetzen können, ist von Caesar pflichtgetreu und nach reicher Entlohnung ihrer Dienste, aber auch unter gelungener eigener Imagepflege glänzend gelöst worden. In Fällen unerläßlicher Enteignungen hat er generös gezahlt und entschädigt, ließ überhaupt außerordentlich schonend verfahren und hat nach Möglichkeit auf Staatsbesitz und auf aus eigener Tasche hinzugekauftes Land zurückgegriffen. Einiges an Härten konnte aber anscheinend doch nicht vermieden werden, weil die Veteranen bequem und patriotisch darauf bestanden, in Italien zu bleiben, aber dann nach Möglichkeit in bereits vorhandenen Ortschaften, verstreut über das ganze Land, angesiedelt werden mussten, wodurch sie sich allerdings auch weit besser kontrollieren ließen, als wenn sie in separaten Ansiedlungen untergebracht worden wären. Und gleichzeitig gewann Caesar auf diese Weise überall Stützpunkte seiner Macht dank der ihm treu ergebenen, zu Bauern gezähmten, also der darniederliegenden Landwirtschaft wieder aufhelfenden und für stabile Verhältnisse im Land sorgenden Ex-Legionäre, ohne deren Anhänglichkeit an die Julier-Familie Augustus niemals seinen Aufstieg hätte antreten können. Die gleiche kluge Politik zu eigener Machtabsicherung, aber auch immer zugleich zu Nutzen des Reichs, hat er ebenfalls mit der vom Senat zwischenzeitlich, seitdem die Gracchen mit solchen Plänen gescheitert waren, zwar boykottierten, aber von Caesar erfolgreich wieder aufgenommenen Kolonisation verfolgt, zumal in den klimatisch den italienischen ähnlichen Gebieten in Spanien, Südfrankreich und Nordafrika, wozu sich auch manche Veteranen und zumal mittellose städtische Plebejer haben ködern lassen – auf ganz friedlichem Weg gelangte so mehr römische Ordnung in die Provinzen. Ebenfalls die Wiederbesiedlung von im Zuge der imperialistischen Eroberungskriege verwüsteten größeren Städte wie Karthago und Korinth hat Caesar in Angriff genommen, vielleicht als Wiedergutmachung von Schandtaten in der Vergangenheit zu verstehen, mithin ebenfalls zum Zwecke von Versöhnung und Befriedung der Einwohnerschaften im römischen Reich. Aus demselben Interesse an Durchorganisierung und Dezentralisation sowie zur Vorbereitung der Romanisierung der eroberten außeritalischen Länder des Reichs, im Grunde also völlig konform mit bewährt altrömischer, auch gut republikanischer Politik, die nur im vorausgegangenen Jahrhundert unter den kleinmütig-starrsinnigen Klasseninteressen der Optimaten und ihrer ängstlichen Sorge um Privilegien und Reichtümer verebbt war, hat Caesar auch die Verleihung des römischen Bürgerrechts großzügig vorangetrieben, es längst überfällig beispielsweise den Einwohnern des nördlichen Italiens verschafft sowie etlichen Ortschaften Voll- oder Halbbürgerrecht verliehen, sogar einzelnen Personen in Spanien, Sizilien, Gallien, Afrika, Asien.
Das alles scheint mir unmissverständlich dafür zu sprechen, dass Caesars Tätigkeit und Fürsorge vornehmlich dem Reich gegolten hat, nicht mehr engstirnig der Stadt Rom, was dort natürlich Unmut erregte, weil es die Vormachtstellung der Stadtrömer beeinträchtigte, zumal Caesar auch in der Hauptstadt mächtig aufzuräumen begonnen hat. Die Masse der notorischen proletarischen Getreideempfänger in Rom hat er um die Hälfte reduziert, von dreihundertzwanzigtausend auf einhundertfünfzigtausend, die seiner Meinung nach überzähligen wurden in die Kolonien verschickt. Damit war ein großer Unruheherd in der Hauptstadt zwar nicht vollständig beseitigt, aber doch verkleinert worden. Denn all diese in der Regel unzufriedenen Erwerbslosen und Müßiggänger standen zum Stimmenkauf auf Abruf bereit und förderten so Anarchie und Korruption, und zudem war mit dieser Maßnahme von Caesar nachdrücklich demonstriert worden, dass er überparteilich zu regieren gedachte und keineswegs in irgendeinem Sinne von demokratisch. Auch den populistischen Forderungen nach einem für den besitzlosen Pöbel vollständigen Schuldenerlass hat er nicht nachgegeben, sondern eine Regelung der Geldverhältnisse eher zum Vorteil der reichen Gläubiger veranlasst. Seine urrömische Aristokratengesinnung hat er also keineswegs verleugnet, aber ist den eingewurzelten Vorurteilen und staatsgefährdenden Verholzungen der Oligarchenpartei schroff entgegengetreten mit seinem Anspruch auf Alleinherrschaft sowie seinen programmatischen Maßahmen zum Ausgleich der Klassengegensätze und zur Förderung einer die territorialen Grenzen des Stadtstaates überwachsenden Reichsordnung und -gesinnung.
Caesars Bestreben und rastlose Tätigkeiten in diesen letzten Monaten seines Lebens haben also vordringlich der Neuordnung des Reiches gegolten. Genügend Machtfülle dazu stand ihm zur Verfügung, auch wohl die Erkenntnis der Notwendigkeit, einen der Alleinherrschaft entsprechenden Einheitsstaat zu schaffen. Aber unerlässlich zur Durchführung dieses Vorhabens war, dass er als einzige, allen übergeordnete Instanz auch alles in seiner Hand behielt, um der neuartig sich ergebenden wirtschaftlichen, finanztechnischen, sozialen und verfassungsrechtlichen, überhaupt juristischen – auch die öffentliche Rechtssprechung hat er sich ja nicht nehmen lassen – Probleme hinsichtlich solch staatlicher Neuorganisation Herr zu werden. Denn was vorerst, aber im Grunde unentbehrlich, dazu noch fehlte, war eine ihm zur Verwaltung des Riesenreiches ausgebildet zur Verfügung stehende, reibungslos funktionierende Beamtenschaft, ans Dienen gewöhnt und im Dienen ihr Selbstbewusstsein suchend und findend, ihre „dignitas“. Doch ganz davon abgesehen, dass ihm gar nicht die Zeit verblieb, sich den dazu erforderlichen Riesenverwaltungsapparat mit Hilfe seiner Ministerialbürokratie aufzubauen, ist weder seine öfters demonstrativ geäußerte Verachtung von Senat und Optimatenpartei dazu geeignet gewesen, ihm aus dieser Schicht fähige Mitarbeiter zur Bewältigung dieses Großunternehmens anzuwerben, noch ist die im altrepublikanisch-aristokratischen Geist zwar gutgemeinte, aber erfolglose Gesetzgebung wider den grassierenden Müßiggang und Luxus der Reichen hilfreich gewesen und ebenfalls andere Versuche nicht, die Moral und Staatswilligkeit der höheren Stände zu heben, beispielsweise mit Prämien zur Förderung des Kinderreichtums usw. Gegen die großwettermäßig veränderten Lebensumstände haben diese Maßnahmen auf längere Sicht nichts auszurichten vermocht, weil ihm keine willfährige und der Reorganisation des Reiches geistig-sittlich gewachsene Elite zur Verfügung stand, die „seine Worte wie Gesetze“ (77) hätte achten können und befolgen wollen, wie Sueton Caesars diesbezügliches Wunschprogramm überliefert hat. Wohl hatte er den Senat von sechshundert auf neunhundert Mitglieder aufstocken können, aber die Absicht dahinter dürfte kaum eine andere gewesen sein, als im Senat ein arbeitsfähiges Gremium für sich zur Hand zu haben. Dazu hatten im Senat nunmehr auch Männer aus den Provinzen Platz gefunden, denen er das gleiche Anrecht auf einen Senatssitz gewährte wie den alteingesessenen Stadtpatriziern, darunter sogar Angehörige der Bundesgenossen, beispielsweise aus Gallien, und verdiente Offiziere, auch Freigelassene, denen er sich auf diese Weise erkenntlich zeigen konnte und die danach bereitwillig seine Anordnungen unterstützten und seine Gesetzesvorlagen abwinkten – zur Willfährigkeit der alten Familien zur Mitarbeit hat das aber wohl kaum verholfen. Im Übrigen verließ er sich vollständig, schon weil er vorerst gar nichts anderes zur Hand hatte, auf seine bewährten Mitarbeiter aus den alten Gallien-Zeiten – von Eduard Meyer ist die so geschaffene Einrichtung treffend „Kabinettsregierung“ genannt worden (S. 430). Es handelte sich dabei um lauter fähige Leute seines Vertrauens, beispielsweise eines Balbus aus Spanien und des Bankiers Oppius, den beiden Vorständen der Regierungskanzlei, vorzügliche Organisatoren und Diplomaten, geschäftstüchtige Machtpolitiker, reich geworden wie ihr Chef und durch ihn, und diesem gegenüber völlig loyal. Diesem Stab gehörten schließlich, wie Cicero berichtet hat, einschließlich der Militärs zu Caesars und seiner Minister Schutz, an die zweitausend Mitarbeiter an. Diese bildeten fortan die ständige Gefolgschaft der Regierungsmannschaft, bereit, allen Wünschen, Vorhaben, Anordnungen, Gesetzen Caesars und seiner Kanzler in gehorsamem. karriereförderndem Dienst prompte Verwirklichung zu verschaffen, der Senat hatte danach nur noch abzusegnen.
Caesars Pläne für die Zukunft waren großartig über alle Maßen und scheinen mir kaum für einen erlahmten Tatendrang zu sprechen, wie von einigen Zeitgenossen unterstellt und es von überlieferten Äußerungen von ihm unterstützt zu werden scheint – es mag hier genügen, ein Resümee der Vorhaben aus Plutarch zu geben, ob dessen psychologische Deutung von Caesars Motivation dafür zur Erklärung ausreicht, erscheint mit äußerst fraglich. Denn dass all das miteinander, auch die Riesenbauten, die in Rom geplant waren, zwar zuallererst der Befriedigung seines Anspruchs an sich selbst Genüge tun sollten, seiner „magnitudo animi“ oder meinetwegen auch seinem Machtwillens, aber ausnahmslos doch auch dem Herrschaftsanspruch und der Wohlfahrt des römischen Reichs gedient haben, scheint wenigstens mir, zusammen mit dem bisher An- und Ausgeführten, von einer exzeptionellen Größe und sittlichen Statur Caesars zu zeugen, denen nicht mit Ansetzung allein der üblichen Motive von Ehrgeiz und Ruhmsucht beizukommen ist. Und für die Berechtigung solcher Enschätzung in Zeiten der gesamten Antike mehr zu verlangen, als eine in die individuelle Selbstbehauptung ehrenvoll integrierte allgemeine Selbstbehauptung eines Volkes, eines Staates, einer Nation oder welchen Gemeinsam-Ganzen auch immer, will mir die damaligen Individuen neuzeitlich-moralisch und individualistisch überfordernd erscheinen. Plutarch berichtet:
„Von der Natur hatte Caesar Ehrgeiz und hochgemuten Tatendrang mitbekommen, so daß all seine vielen Erfolge ihn nicht dazu verlocken konnten, die Früchte seiner Mühen ruhig zu genießen, im Gegenteil, sie feuerten ihn an und stärkten sein Vertrauen in die Zukunft. In seiner Phantasie gestalteten sich immer gewaltigere Pläne, er sehnte ich nach neuem Ruhm, als sei der alte schon verbraucht und abgenutzt. Eine leidenschaftliche Unruhe erfüllte ihn, er war auf sich selber eifersüchtig wie auf einen Nebenbuhler und vom Wunsch besessen, die Taten der Vergangenheit in der Zukunft zu übertreffen. So war der Entschluß in ihm gereift, gegen die Parther zu ziehen, und die Vorbereitungen für das Unternehmen wurden schon getroffen. Er wollte, wenn er die Feinde niedergeworfen, durch Hyrkanien am Kaspischen Meer und dem Kaukasus hin um das Schwarze Meer herumziehen und ins Gebiet der Skythen einfallen, dann die Nachbarländer der Germanen und diese selbst bezwingen und schließlich durch Gallien nach Italien zurückkehren, um auf diese Weise den Kreis zu schließen und überall den Ozean zur Reichsgrenze zu machen.
Während des Feldzugs sollte der Isthmos von Korinth durchstochen werden; als Leiter dieses Werks war Anienus schon bestimmt. Er plante auch, den Tiber gleich von der Stadt weg in einen tiefen Kanal zu fassen, in einer Schleife zum Vorgebirge von Circei zu leiten und bei Tarracina ins Meer münden zu lassen, um den Kaufleuten einen sicheren und mühelosen Seeweg nach Rom zu öffnen. Überdies wollte er die Sümpfe in der Gegend von Pometia und Setia trockenlegen und dadurch für Zehntausende von Menschen ergiebigen Ackerboden gewinnen. Das Meer vor den Toren Roms gedachte er durch Dämme in Zügel zu legen, die gefährlichen Untiefen an der Küste von Ostia zu beseitigen und Häfen und Ankerplätze zu schaffen, welche den bedeutenden Schiffsverkehr zuverlässig meistern könnten. Für alle diese Pläne waren die Vorbereitungen im Gange“ (58; vgl. Sueton; 44).
Aber lassen sich diese gigantischen Vorhaben denn überhaupt anders als die, mag sein, hochfliegenden, gleichwohl maßlos überspannten Welteroberungs- und Weltverbesserungsträume eines megalomanen Despoten werten, und die angeführten, sagen wir, zivilisatorischen Projekte nur für die leichtfertigen Illusionen eines Phantasten halten, was gegen Caesar alles ja sehr wohl vorgebracht worden ist? – meiner bisherigen Deutung seines Wesens würden solche Aburteikungen allerdings vollständig widersprechen. Doch, wie bereits wiederholt vorgebracht, bin ich mitnichten davon überzeugt, dass die gängigen Erklärungsspielmarken: Ehrgeiz und Ruhmsucht ausreichen würden, wie sie ja auch von Plutarch gebraucht worden sind, um Caesars Wesen und Wollen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Muss sich einem wirklich die Ansicht aufdrängen, dass der Nach-Bürgerkrieg-Caesar nicht mehr der seiner großen Zeiten in Gallien gewesen ist, sondern alt, krank und schwach geworden wäre und sich vor den schier unlösbar erscheinenden politisch-organisatorischen Problemen der Staatsgeschäfte in Rom, der Verantwortung für die Neuordnung der Regierungsinstitutionen sowie der Verlegenheit, welches Antlitz seine Alleinherrschaft in Stadt und Reich haben sollte, mut- und ehrlos in einen exotischen Riesenkrieg hätte stürzen wollen und sich in Utopien menschenbeglückender Großbauunternehmungen geflüchtet habe? Sehen wir also in der Folge genauer zu, wie unter meiner Prämisse des „dem“ Römer zwar spezifisch eigentümlichen, in Caesar aber sozusagen personifizierten, ungemeinen Machtwillens sich diese beiden letzten Vorhaben, das römische Reich zu seiner und Roms Ruhm und Größe bis zur Begrenzung durch die beiden Ozeane – das Kaspische Meer galt als Ozean – auszudehnen und abzurunden, um Roms Herrlichkeit und die Wohlfahrt der Nation in Hauptstadt und Reich geziemend zu mehren und für alle Ewigkeit abzusichern, was, als allgemeines Ziel der geplanten Ausweitung des Reichs auf den orbis terrarum sowie unter Berücksichtigung der angeordneten und z.T. bereits in Angriff genommenen bautechnischen Maßnahmen anzuerkennen, der Umbauten und Großbauten, der Versammlungs- und Vergnügungsgebäude, nicht gar zu vermessen und unmöglich erscheinen sollte. Oder anders gewendet: Lassen sich Caesars Pläne und Tätigkeiten zu Ende seines Lebens unter Voraussetzung des zuvor Gelebten und Geleisteten nicht glaubhaft mit Aristoteles einfach als Auswirkung seiner „Selbstliebe“ auffassen: „denn von seinem edlen Handeln wird er (der Megalopsychos, d. Verf.) selbst Gewinn haben und auch die anderen fördern“ (Nik. Eth. 1109a), so dass ihm mit Fug und Recht „Megalopsychia“ im Sinne von „Hochsinnigkeit“ zugebilligt werden könnte – als jemandem, „der sich hoher Dinge für wert hält und es auch wirklich ist“ (1123b)? Oder im Verständnis von Nietzsches „Umwertung aller Werte“: Muss Caesars immenser Machtwille, sein „Wille, selbst zu sein, sich abzuheben“ (Götzen-Dämmerung, Streifzüge eines Unzeitgemäßen; 37), von vornherein und bedingungslos als totaler Immoralismus verurteilt werden; oder ließe sich sein Wesen und Ethos auch anders beurteilen, so denn Nietzsches Unterscheidung und Kriterien beachtet würde: „Die Selbstsucht ist so viel werth, als Der physiologisch werth ist, der sie hat: sie kann sehr viel werth sein, sie kann nichtswürdig und verächtlich sein“ (ebd.; 33) – was also war Caesars Selbstsucht wert?
Bei dem nachfolgenden Versuch, Rang und Rätsel von Caesars ethischer Persönlichkeit näher zu kommen, gehe ich, wie längst gesagt, davon aus, dass er nicht, wie von Sueton (vgl. 30) und auch von Plutarch (vgl. 3) vorgebracht, von Jugend an nach der Alleinherrschaft gestrebt hätte, um nicht zu sagen nach der Monarchie, wie es bis in die Gegenwart als beharrlich verfolgtes Ziel seiner unmäßigen Ehr- und Ruhmsucht nachgeredet worden ist, sondern dass ihm die Alleinherrschaft nach Pharsalus unversehens in den Schoß gefallen ist, bis wohin er wie jeder Römer, der etwas auf sich hielt, „nur“ danach gestrebt hätte, der Erste im Staat zu werden; dass ihm aber danach, zum Alleinherrscher aufgestiegen, gar nichts anderes übrig blieb, als seinen längst zu seiner zweiten Natur gewordenen Herrschaftswillen zu behaupten und noch zu steigern, Macht und Herrschaft unbedingt zu wollen, um sie für sich und Rom produktiv werden zu lassen; oder, noch wieder anders ausgedrückt, um seinem gewiss selbstgefälligen, selbstgerechten, über die Maßen selbstsicheren, auch selbstischen und selbstgenießerischen, aber ebenfalls ungemein selbständig-selbstbestimmten Selbstverwirklichungsanliegen mit dem Selbstbewusstsein des Hochsinnigen und voller Selbstvertrauen zu seiner eigenen Befriedigung nachzukommen. Ein weiteres Mal möchte ich mich, was damit im Grunde Zeit seines Lebens, aber zumal gegen sein Lebensende hin von ihm selbst wohl gemeint und beabsichtigt gewesen sein könnte, mit Hilfe von zwei, drei von ihm überlieferten, z. T. bereits gestreiften und genutzten Selbstaussagen anzunähern versuchen. Schon im Jahre 61, noch vor Aufnahme seiner Verwaltungstätigkeit in Spanien, soll er laut Plutarch geäußert haben, wonach sogleich sein bereits zitierter missmutiger Vergleich mit Alexander folgte, was beides seine damalige Lebensstimmung, aber zugleich die von ihm gewählte Lebenswahl, meine ich, vorzüglich zu kennzeichnen erlaubte: „Ich wenigstens wollte lieber hier (gemeint war damit ein armseliges Barbarenstädtchen in den Alpen, d. Verf.) der Erste als in Rom der Zweite sein“ (11). Und bei Sueton findet sich vergleichbar, nachdem er endlich Galliens Herr geworden war und ihm in Rom die üblichen Schwierigkeiten bereitet wurden: „Es sei schwerer, ihn, den ersten Mann des Staates, vom ersten Platz auf den zweiten als vom zweiten auf den letzten zu verweisen“ (29). Lassen sich derartige Aussprüche anders verstehen, als dass für Caesar Wunsch und unbedingter Wille, der Erste zu sein, das alles beherrschende Begehren seiner geistigen Existenz gewesen sind? Als es aber endlich erreicht war, er in der Tat der Erste, ja der Einzige in Rom geworden war: Wie hat er sich damals zum Erreichten und noch zu Erreichenden, gegebenenfalls noch zu Leistenden selbst geäußert? War seinem Machtwesen Genugtuung geworden? War er zufrieden? Von Cicero wie von Sueton ist von zwei gleichsinnigen Selbstaussagen Caesars berichtet worden, die diesbezüglich zu denken geben. Cicero (pro Marcello, 25, zit. Seel: Caesar-Studien, S. 74): „Lange genug habe ich gelebt, sei’s für Menschenart (natura), sei’s für den Ruhm (gloria)“. Und Sueton: „Es sei nicht so sehr in seinem Interesse als in dem des Staates, daß er am Leben bleibe, er habe schon lange den Gipfel der Macht (potentia) und des Ruhms (gloria) erreicht; falls ihm etwas zustoßen sollte, werde der Staat nicht in Ruhe bleiben können, sondern nur noch schlimmere Bürgerkriege erleben“ (86).
Sollten diese beiden Aussagen für authentisch und aufrichtig genommen werden dürfen, sprächen sie wohl eindrücklich dafür, meine ich, dass erstens Caesars geistige Klarsicht ungetrübt geblieben und er zweitens an Selbstsicherheit, trotz einer gewissen Selbstkritik, noch dazu gewonnen hätte; zumindest an seiner körperlichen Leistungsfähigkeit, wie unlängst noch bei Munda unter Beweis gestellt, altersbedingt nachlassende Vitalität abgerechnet, lässt sich kaum begründet zweifeln.
So man nun die beiden Vorhaben, die geplanten kolonisatorischen Unternehmungen und den Welteroberungsfeldzug, im Rückblick auf Caesars von mir ihm zugesprochenes Wesen und Wirken wie im Ausblick auf die realistischen Chancen, die beiden Zielsetzungen zuzubilligen wären, zu beurteilen versuchte, dürfte es im ersten Fall kaum größere Schwierigkeiten bereiten, ihn vom Vorwurf eines größenwahnsinnig gewordenen Despoten freizusprechen. In Ansehung der Machtmittel, die ihm als Alleinherrscher des römischen Reichs zur Verfügung standen, aber auch in Erinnerung an das mit seinen Legionären von ihm in Gallien Geleistete, zunächst noch unabhängig davon gewertet, was für einen Preis die dortige Bevölkerung dafür gezahlt hatte, wo ihm die nachhaltige Eroberung des an den damals ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen, auch in puncto Verkehrsmittel geurteilt, riesigen Gebietes doch vornehmlich kraft seiner überlegenen Autorität und seiner Führungsqualitäten gelungen war, aufgrund derer er nicht nur den Gehorsam, sondern den stolzen, ja begeisterten Dienst- und Pflichteifer seiner Soldaten zur gemeinsamen Vollbringung der Sache Roms gewonnen hatte, lässt sich doch kaum in Zweifel ziehen, er hätte seine gemeinnützigen Vorhaben nicht tatkräftig und mit Unterstützung aller umsetzen können: Eindämmung des Meeres; Schaffung sicherer Häfen; bessere Anbindung der Hauptstadt ans Meer durch einen Kanal; Gewinnung von fruchtbarem Land mit Beseitigung der wegen Seuchengefahr bedrohlichen Sumpfgebiete; von den riesigen, z. T. bereits in Angriff genommenen Bauvorhaben zur Verschönerung und erhöhten Wohnqualität der Hauptstadt ganz abgesehen – ohne Zweifel allesamt zweckdienliche Maßnahmen zur Lebensverbesserung der Bevölkerung, die wohl kaum auf großen Widerstand gestoßen wären. Doch brauchte ihm deswegen weder fürsorgliche Menschenfreundlichkeit noch simpel persönliche Ehr- und Ruhmsucht unterstellt zu werden, die ihn allein zu solchen Plänen bewogen hätten. Denn zumindest gemäß der soeben angeführten Aussprüche war ihm sein erstrebtes Maß an Ehre und Ruhm längst reichlich zuteil geworden, und zudem, bin ich überzeugt, ist ihm bei seiner kaum zu übersehenden, wachsenden Menschenverachtung aufgrund seiner schier unheimlichen geistigen Überlegenheit und erreichten Höchstrangigkeit, was nur allzu leicht zu Hochmütigkeit und Überheblichkeit verführte, am Ansehen bei seinen Zeitgenossen – denn danach geht ja das Trachten des Ehrgeizes – wohl nur noch wenig gelegen gewesen. Und an der Ewigkeit des Ruhms bei der Nachwelt dürfte er ebenfalls seine Zweifel gehabt haben, denn dass ein Caesar, antiker Mensch durch und durch, nicht zutiefst vom Bewusstsein der Vergänglichkeit alles Irdischen, also auch des Ruhms durchdrungen gewesen wäre, vermag ich mir bei diesem skeptischen Epikureer jedenfalls nicht vorzustellen. Zur Erklärung der zivilisatorischen Großvorhaben, meine ich, wäre es daher verständiger anzunehmen, Caesars tief eingefleischter Macht- und Herrschaftswille, seine stolze Selbstachtung, seine Großzügigkeit und sein überbordender Lebensreichtum hätten es ihm nunmehr geradezu aufgezwungen, sich nach Beendigung des Bürgerkriegs um Ordnung und Segen stiftende Aktivitäten für Volk und Vaterland zu kümmern und den Überreichtum seines Inneren zum Heile Roms zu verströmen. Denn wozu sonst hatte er die Macht erstrebt und jetzt erlangt, als um durch sie ermächtigt wirken zu können, produktiv werden zu können, kreativ, mit einem Wort, um zu herrschen und Rom und Reich eine neue, seinem Geist und seiner Größe gemäße Verfassung zu schaffen. Dass seine kolossalen kolonisatorischen Pläne von kritischen Modernen lieber als Größenwahnsinn ausgelegt, denn einer eigenen Größe zugute gerechnet worden sind, mag auch damit zusammen hängen, dass den Europäern ihre Kolonisierungsaktivitäten zumal im 19. Jahrhundert längst als Verbrechen und zu untilgbarer Schande vorgeworfen werden, aber wohl auch, dass solch zivilisatorische Großtaten, worin die Römer sich als wahre Meister erwiesen haben – wie Straßen- und Brückenbau; Versorgung mit Wasser, auch zu Zwecken der Hygiene; Steinbauten zum Schutz vor Witterung und Feinden; komfortable Wohnhäuser und wohl erst seit dem vorigen Jahrhundert an Größe und Glanz übertroffene öffentliche Bauten zum Zwecke von Geselligkeit und Vergnügen, zu „Entspannung und Genuss“, wie man’s heute nennt, wie beispielsweise die zahllosen Theater und Amphitheater vom unübertroffenen Typ „Colosseum“ oder die gigantischen Bäder, Typ Caracalla-Thermen –, wert- und rangmäßig noch heute weit geringer eingeschätzt werden als Tempel und Kirchen und bestimmt unvergleichlich geringer auch als damals die Menschen selbst noch in den entlegensten Provinzen des Reichs, wo diese zivisilatorischen Errungenschaften hoch und am höchsten geschätzt wurden, solange man sie schmerzlich entbehrte, ähnlich wie es heutzutage in den sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern mit Trinkwasser, Kanalisation, Elektrizität, Straßen und Eisenbahn, Autos und Fahrrädern usw. der Fall ist. Nach erreichter Absättigung pflegt dergleichen für das Gewöhnlichste von der Welt gehalten zu werden, ein jeweils erreichtes Nullniveau, dem wenig Beachtung und Wertschätzung geschenkt wird, wie es in der Gegenwart mit den in den westlichen Ländern selbstverständlich gewordenen technischen Errungenschaften der Daseinsvorsorge geschieht, mit dem Komfort von Licht, Wärme und Wasser, mit Arbeitserleichterungen aller Art und gelieferter Unterhaltung bis ins letzte Wohnzimmer, mit WC, kaltem und warmem fließendem Wasser, Gasheizung, Kühlschrank und Waschmaschine, Telefon, Fernsehen, Internet, Mobiltelefon usw. Für Caesar möchte demnach wertmäßig gelten, was Goethe seinen alten Faust hat sagen lassen, und was nach den faszinierenden Ausführungen Otto Seels dazu (vgl. Caesar-Studien, S. 92 ff.) vom Caesar-Kaiser des zweiten Teils des „Faust“ als dessen hohes Wesen gedeutet und vielleicht vom Dichter sogar als sein eigenes und überhaupt das allerhöchste Lebensziel gewertet worden sein könnte: „Herrschaft gewinn ich, Eigentum! / Die Tat ist alles, nichts der Ruhm“ (10187). Und dann hat Goethe seinen Faust für den Kaiser den Krieg gewinnen und ihn „kolonisieren“ (11274) lassen und ihn, wie Caesar es geplant hat, einen schiffbaren Kanal bauen (vgl. 11146) und dem „faulen Pfuhl“ (11559) fruchtbares Land abgewinnen lassen. Und der historische, der gebildete und geistig interessierte Caesar hat sich sogar um die Anhebung der geistigen Kultur seiner Landsleute gemüht, hat große Bibliotheken und ein Riesentheater geplant gehabt, das Zivilrecht gestrafft und den Kalender und dadurch den römischen Alltag wohltuend neu geordnet (vgl. Sueton; 44; Plutarch; 59).
Doch neben diesen Kolonisationsplänen und Reformierungsabsichten und -taten zur Verbesserung der Lebensbedingungen in Stadt und Reich hat es ohne Frage auch die Kriegsvorbereitungen gegeben, die Welteroberungspläne, die tolle Absicht, „überall den Ozean zur Reichsgrenze zu machen“ (Plutarch; 58), mithin „orbis terrarum“ und „imperium Romanum“ zu einem Eins und Alles zu schaffen – läßt sich solch Projekt denn überhaupt anders auffassen denn als Phantasterei, Größenwahn, Flucht aus der Wirklichkeit? Hat der nüchterne Realist, der sich Zeit seines Lebens als ein – mit den Notwendigkeiten rechnender und mit den sich daraus, wenn mit klarem Kopf ergriffen und mit tatkräftigem Willen angegangen, vorteilhaft ergebenden Möglichkeiten – Mann der Tat bewiesen hatte, sich zuletzt in völlig haltlosen Illusionen und in neurotischen Zwängen verloren, noch den großen Alexander überbieten zu müssen? Ich selber bin nicht davon überzeugt, obwohl manches sich so ausnimmt, dass sich ein derart simpler Reim auf seine Vorhaben machen ließe, und im Übrigen ist kaum Abgesichertes darüber beizubringen, was in seinen letzten Lebensmonaten in Caesars Innerem vor sich ging, letztlich wird auch hier alles Mutmaßung bleiben müssen nach Maßgabe des eigenen Gesamtbildes – aber man kann es, meine ich, noch ein wenig differnzierter sehen.
Zunächst könnte dem Gedanken einer Rivalität Caesars mit Alexander sehr wohl Raum gegeben werden – welcher andere Erste und Große wäre denn ansonsten noch für ihn in Frage gekommen, den er noch hätte übertreffen wollen? Alexander seinerseits hatte sich klugerweise den mythologischen Achill zu seinem Vorbild ausgesucht und konnte sich dann lebenslang von diesem kaum überbietbaren Konkurrenten zu seinen Großtaten angespornt fühlen. Ganz selbstverständlich ist Alexander auch von Plutarch zum Vergleich mit Caesar herangezogen worden, und der Wunsch und das leidenschaftliche Begehren zu einem Triumph Roms über Griechenland wäre Caesar, dem Römer comme il faut, meine ich, durchaus zuzutrauen. Von Eduard Meyer ist die ganze Angelegenheit nach meiner Überzeugung auf den Punkt gebracht worden: „Die Monarchie Caesars ist ihrer Idee nach die Wiederaufnahme und volle Durchführung der Weltmonarchie Alexanders: die Welteroberung, im vollsten Sinne des Wortes, ist ihre Voraussetzung und ihre Rechtfertigung. Sie ist zugleich das Ziel, auf das nicht sowohl die Entwicklung der römischen Macht, als vielmehr die gesamte Kulturentwicklung der antiken Welt seit Jahrhunderten hingedrängt hatte und die noch nie zur Wirklichkeit geworden war“ (S. 472). Und Meyer hat fortgesetzt: „Diese großen Unternehmungen durchzuführen war in der Tat eine Aufgabe, die eine zielbewußte Verwendung der Gesamtkräfte des Reichs unter genialer Leitung erforderte und Caesars würdig war“ (S. 474). Nach dieser Belehrung durch den großen Historiker, dem ich ebenfalls bei der Frage nach dem Selbstverständnis des „Monarchen“ Caesar Folge leisten möchte, mag man, sozusagen zum allgemeinen Motto von Caesars geistiger Existenz erhoben, sich gedrängt fühlen, Goethe/Fausts römischen Geist atmender Bibelübersetzung zuzustimmen: „Im Anfang war die Tat“ (1237). Unter dieser Voraussetzung ließe sich auch gut nachvollziehen, wieso Goethe Caesars Ermordung die „abgeschmackteste That“ genannt hat, „die jemals begangen worden“ ist (zit. Seel: Caesar-Studien, S. 100), weil „selbst die Besseren (d. h. seine Mörder, Brutus und Cassius, d. Verf.) (nicht) begriffen, was regieren heißt“ (ebd.); woraus Goethe (in: Shakespeare und kein Ende, zit. Seel, ebd., S. 131) in seiner Deutung von Shakespeares „Caesar“ schlusszufolgern geglaubt hat: „Im Caesar bezieht sich alles auf den Begriff, daß die Besseren den obersten Platz nicht wollen eingenommen sehen, weil sie irrig wähnen, in Gesamtheit wirken zu können“ (S.131) – in der Tat, wer anders denn ein Caesar hätte sich im Vertrauen auf seine Macht, auf seinen Tatwillen, auf seine Tatkraft, auf sich selbst, die Fähigkeit zum Regiment über den „orbis terrarum“ nach einem Welteroberungsfeldzug, von ihm auf drei, vier Jahre kalkuliert, zu Recht überhaupt anmaßen dürfen, wer anders denn der einzige Caesar?
Und dass er nicht gründlich für den Erfolg vorgesorgt hätte, kann ihm nicht gut zum Vorwurf gemacht werden. Spätestens seit Munda, vielleicht schon nach dem Ägyptenabenteuer, hat er sich anscheinend ausgiebig mit dem Feldzug gegen die Parther beschäftigt, zehn Legionen mit zusätzlich zehntausend Reitern waren für das gewaltige Unternehmen eingeplant, nach Schätzung Eduard Meyers zusammen mindestens hunderttausend Mann (vgl. S. 476). Sechs Legionen samt Tross und Leichtbewaffneten, darunter auch der designierte Nachfolger Octavian, waren bereits über das adriatische Meer vorausgeschickt worden, mit weiteren Legionen wollte Caesar alsbald zu ihnen stoßen. Der Krieg war amtlich beschlossen, die Geldmittel dafür bewilligt worden (vgl. Meyer, S. 474) – wer hätte denn dieser bestens ausgerüsteten Kriegsmaschinerie, welche die Welt bis dahin gesehen hatte, Widerstand leisten können, zumal unter Führung des anerkannt größten Feldherrn und Führers, den Rom je hervorgebracht hat?
Ich halte es daher für überaus wahrscheinlich und durchaus plausibel, dass Caesar in diesem Weltkriegsabenteuer eine letzte große Herausforderung an seine Megalopsychia erblickt hat und sich, dabei vom Erfolg gekrönt zu werden, im Vertrauen auf seine gepflegte und bewährte Glücksspielermentalität sehr wohl versprochen haben könnte, mit der er immer wieder alles auf den einen, entscheidenden Wurf gesetzt hat, in Alesia, am Rubikon, in Pharsalus, Thapsus, Munda, und stets Erfolg gehabt hatte. Doch nicht bloß zu seinem persönlichen, sondern zum welthistorischen Verhängnis hat Venus sich ihm diesmal versagt, die in Gestalt Kleopatras, wie ich es deuten möchte, zu dieser Welteroberungsvision noch maßgeblich beigetragen haben könnte, wovon sogleich: Drei Tage nach den todbringenden Iden des März hatte er aufbrechen wollen. Gleichwohl erscheinen mir auch Vorhaltungen nicht unberechtigt zu sein, zuvor hätte er in Rom die notwendige Ordnung zu schaffen gehabt, anstatt das auf diesem Umweg über die Welteroberung anzugehen – doch wer könnte berechtigt Anspruch erheben, hier das Richtige besser als Caesar selbst zu wissen? Im Grunde müsste doch jeder Satz in diesem Zusammenhang mit einem „vielleicht“ angefangen werden, man vergleiche die auffällige Häufung dieses Wortes auf den Seiten 539, 556, 566 im Caesar-Buch von Christian Meier. Immerhin war Caesar damals schon sechsundfünfzig Jahre alt, zu alt im Vergleich mit Alexander, könnte man meinen, für solche Welteroberungsphantastereien – aber waren es wirklich nur Phantastereien? Auch mit seiner Gesundheit soll es nicht mehr zum Besten bestellt gewesen sein, liest man bei Sueton (vgl. 81) – doch ist von diesem dann Caesars angebliche Unschlüssigkeit, ob er losmarschieren solle, obwohl seit einigen Jahren alles dafür vorbereitet war, zusätzlich zu seinem schlechten Gesundheitszustand von Voraussagen seines baldigen Todes abgeleitet und den üblen Vorzeichen, die es allenthalben gegeben habe, u.a. hätten Pferde Tränen vergossen (vgl. ebd.) – glaubhaft? In Sonderheit eine Äußerung Ciceros, Caesar würde von diesem Kriegszug nie zurückgekehrt sein, sowie Bemerkungen Appians (zit. Seel: Caesar-Studien, S. 91) haben anscheinend starken Eindruck hinterlassen und zu Ansichten beigetragen wie: frühzeitige Alterung (vgl. Heuss: Propyläen, S. 293) und Nachlassen seiner Kräfte etc. (vgl. Meier, S. 545, 567). Voll verzweifelter Hoffnung habe er sich in dieses phantastische Kriegsabenteuer werfen wollen, um von den zu erwartenden harten Strapazen und den unvermeidlichen Schlachten und Siegen wie von einem Lebenselixier gesundheitlich zu profitieren, wieder der alte zu werden, in erneuerter Vitalität und gefestigter Selbstsicherheit. Oder, etwas tiefer angesetzt, er habe, wie im gut gefundenen Untertitel des Caesar-Buches von Werner Dahlheim zum Ausdruck gebracht, in diesem großartigen Welteroberungsfeldzug die „Ehre des Kriegers“ zurückzugewinnen getrachtet; er habe aus der unbefriedigenden Wirklichkeit Roms die Flucht nach vorne angetreten, ratlos, wie die dortigen Probleme zu lösen seien, um endlich alle Welt und Nachwelt von sich zu überzeugen; er habe die Erfüllung seines Lebens dort gesucht, wo es von seinen Landsleuten am höchsten geschätzt wurde, in Kampf und Eroberung; und wo er sie sich am verlässlichsten erhoffen konnte, in einem ehrenhaft bestandenen, glorreich geführten Krieg; und womöglich würde ihm das sogar in der Heimat eingebracht haben, was er dort so schmerzlich entbehrte: Anerkennung, sogar die danach kaum länger verweigerbare allgemeine Akzeptanz seiner Alleinherrschaft, wie immer diese genauer aussähe; und endlich würden dann auch die Vorwürfe verstummen, er trüge die Schuld an dem schrecklichen Bürgerkrieg. Ohne Frage hat er sich darüber, dass ihm der nötige Rückhalt für seine neue Ordnung von Stadt und Reich vom Volk, von den Oligarchen ganz zu schweigen, weitgehend verweigert wurde, wahrlich keiner Täuschung hingeben können – lag es da nicht nahe, sich von den durch nichts zufrieden zu stellenden Aristokraten ein für alle Mal zu verabschieden? Auch sein Erlass allgemeiner Amnestie (vgl. Sueton; 75) hatte an ihrem Widerstand nichts zu ändern vermocht, die in ihm, feindselig, verbohrt, unversöhnlich, allein den Totengräber der Republik sahen, den Todfeind all dessen, woran sie glaubten; hochmütig, unbelehrbar, jeder Neuerung abgeneigt, obwohl doch Caesars Diagnose, dass der alte republikanische Staat die durch das Riesenreich geschaffenen Probleme nicht zu lösen imstande war, nur allzu offensichtlich war; ich sage, hätte es da in der Tat für Caesar nicht nahe liegen können, einfach alles hinter sich zurück zu lassen: die verkrusteten, veralteten Institutionen; alle Enttäuschungen über die anhaltenden Widerstände; die unüberwindliche Missbilligung, auch des Volkes, auch nur des Anscheins, nach der Königswürde zu streben, die er als eine Möglichkeit zur Lösung der drängenden Probleme zeitweise wohl tatsächlich in Betracht gezogen hat, mithin urälteste monarchische Traditionen wieder aufzugreifen, um die überlebten republikanischen endlich zu überwinden? Oder hätte er sich nicht auch gedrängt fühlen können, das ganze Gesindel von unwürdigen Schmeichlern und Speichelleckern im Senat und unter den Patriziern und Rittern, aber ebenfalls in den Reihen seiner scheinbar ergeben-untertänigen Anhängerschaft, die er gleichwohl nicht entbehren konnte, zumindest fürs Erste einmal loszuwerden? Aber trug er im Übrigen nicht ein Gutteil Mitschuld an dieser ganzen Misere, deren lastende Schwere ihn niederdrückte und der er durch solche Flucht zu entkommen hoffen konnte? War er nicht gar zu selbstherrlich geworden in diesen zwölf Jahren Krieg und Sieg, maßlos in seiner Verachtung von Senat wie Volk, ein ungeduldiger, empfindlicher, unbeherrschter Patron, der Posten und Belohnungen zwar großzügig, aber auch demütigend wie Beutestücke verteilte und sich einer geduckten Klientel bediente, die ihn scheinbar in den Himmel hob, um ihn danach desto glaubwürdiger als Tyrann verderben zu können?
Zwar an höchsten Ehrungen hatte es zuletzt wahrlich nicht gefehlt, eher wird man sich fragen müssen, wieso Caesar sie zugelassen, wieso er sich nicht energischer gegen diese exaltierten Feiern und Lobhudeleien verwahrt hat. Und überhaupt: Was wäre mit dem Ruhm eines Welteroberers denn eigentlich anzufangen gewesen? Was hätte danach kommen sollen? Natürlich sind das im Grunde alle miteinander unbeantwortbare, auch müßige Fragen, und ihm selbst hat sein Tod ihre Beantwortung gnädig erspart – dennoch wird man versuchen, einige der Antworten an seiner statt zu geben. An Ehrbezeugungen haben sich Senat und Volk damals geradezu hysterisch überschlagen, aber hatten ihn so ja nur beim Wort genommen, denn angeblich wäre es ihm im Bürgerkrieg ja einzig und allein um die vorenthaltene Ehre gegangen. Und anscheinend war er zuletzt auch zur Überzeugung gekommen, dass sich allein durch sakrale Ehrungen die ihm zugefallene, aber gewaltsam erstrittene, ungesetzliche Usurpation der Alleinherrschaft vor dem Volk legitimieren und auf Dauer absichern ließ. Sein Versuch, über die eingefleischte Abneigung zumindest der Stadtrömer gegenüber der altrömischen Königsherrschaft durch Inanspruchnahme seiner angeblich königlichen Abstammung von Julus, Sohn des Aeneas, Herr zu werden, ist anscheinend am vehementen Widerstand breiterer Kreise der Bevölkerung gescheitert – ein Alleinherrscher, der sich König nannte, war in Rom schlechterdings unmöglich. Daher hat er letztendlich – bereits in die Purpurtoga der etruskischen oder Alba-Könige gekleidet, an den Füßen hohe rote Schuhe, auf dem Haupt einen goldenen Kranz, sitzend auf goldenem Sessel – in einer wohl von seinen Anhängern arrangierten, von Shakespeare eindrucksvoll gestalteten Szene das Königsdiadem unter großem Jubel des Volkes zweimal zurückweisen müssen und es scheinbar pflichtschuldig dem einzigen König Roms, Jupiter Capitolinus, in seinen Tempel bringen lassen. Doch mag ihm in diesem speziellen Fall die Zurückweisung des Königtums, wie es unverhohlen auch Shakespeare hat durchblicken lassen, auch aufgezwungen worden sein, sie wäre in Rom wohl unmöglich durchzusetzen gewesen. Andererseits war auf die solchen Absichten zugrunde liegende sakrale Legitimation nicht gut zu verzichten. Nicht, dass der alte Skeptiker auf seine alten Tage fromm geworden wäre, das halte ich für ausgeschlossen und fühle mich in dieser Überzeugung durch eine Bemerkung Suetons bestätigt, dass Caesar „unter Missachtung jeglicher religiöser Bedenken“ (81), d. h. all der ominösen Vorzeichen vor seinem Tode, die Plutarch (vgl. 63) sich ebenso wenig hat entgehen lassen,32 seinen letzten Gang in den Senat angetreten hat. Dennoch darf man, meine ich, Plutarch (63 f.) und in seinem Fahrwasser auch Shakespeare immerhin so weit folgen, dass Caesar zum Ende nicht mehr ganz auf der früheren Höhe seines Genius gewesen ist; dass er unübersehbar menschliche Schwächen zeigte, als er sich laut Shakespeare noch „standhaft wie des Nordens Stern“ (3.1) dünkte; dass er wankelmütig, vielleicht sogar abergläubisch (vgl. 2.1.) geworden ist, wie es seit jeher wohl selbst in seiner wie eines jeden Römers Natur gelegen war, und nur vermeintlich immun gegen alle Schmeichelei. Und eben dadurch hatten die Schmeichler ihn zu „übermeistern“ (ebd.) vermocht, dass sie ihm versicherten, er sei doch gegen jede Schmeichelei gefeit. Auch von Plutarch ist geargwöhnt worden, durch übertriebene Schmeicheleien sei es seinen Gegnern gelungen, ihn in den Augen seiner Landsleute zu disqualifizieren (vgl. 57) – anscheinend hat ihm daran gelegen sein müssen, gewiss aus politischer Notwendigkeit, aber wohl auch aus Gründen zunehmender Überheblichkeit, sich als „höheres Wesen“ (Plutarch; 60) verehren zu lassen. Unerträglich für frommen Römersinn ist ihm als „Divus Julius“ zum Lobpreis seiner göttlichen „clementia“ ein Tempel geweiht und zu seinem Kult ein spezielles Flaminat begründet worden (vgl. Eduard Meyer, S. 513 f.). In den Tempeln wurden Statuen aufgestellt, denen an seinem Geburtstag von Staats wegen zu opfern war, eine davon versehen mit der Inschrift „deo invicto“, dem unbesiegten Gott usw. Kurz, ganz wie im eingerissenen Herrscherkult des Orients längst gang und gäbe, war auf Beschluss des Senats und wohl auch mit Zustimmung erheblicher Kreise der Bevölkerung der Kult eines gottgleichen Herrschers zu seiner Ehrung eingeführt worden – die Sehnsucht nach einem göttlichen Heiland und Friedensbringer muss nach den Erfahrungen mit den unseligen Bürgerkriegen und überhaupt den jahrhundertelangen Kriegen Roms in Stadt wie Reich gar zu verführerisch gewesen sein. Nach den Gräueln des vorgeblichen Rachezugs für seinen ermordeten Vater, den „Gott Julius“, zu dem er ihn hatte postum verklären lassen, ist Vergils berühmte Prophezeiung und Preisung des kosmischen Herrschers und Friedensfürsten dann dem neuen Caesar, sprich Augustus, zu willkommener Beute in die Hände gefallen, die dem alten versagt geblieben war.
Und diese Verheißung „ewigen“ Friedens hat damals den Bedürfnissen der Völker im römischen Reich so vortrefflich entsprochen, dass sie von den Christen mit überwältigendem Erfolg für ihren göttlichen Friedensbringer beschlagnahmt werden konnte und seit Kaiser Konstantins Erhebung des Christentums zur Staatsreligion den Weg zur Theokratie, zum byzantinischen Cäsaro-Papismus gebahnt hat, der vom Islam mit seinen auch für geistliche Fragen zuständigen Kalifen und Sultanen erfolgreich aufgenommen und fortgeführt wurde – noch heutzutage beanspruchen die Ajatollahs und Mullahs im Iran und selbsternannte Kalifen unverfroren ihre göttliche Legitimation zur unumschränkten politischen Machtausübung im Namen Allahs. Dagegen ist der Sieg des absolutistischen Orients im Westen zufolge des Machtkampfs von weltlichem Kaiser- und geistlichem Papsttum, die sich gegenseitig den höchsten Rang auch im jeweilig anderen Bereich streitig machten, über die Jahrhunderte des Mittelalters hindurch einigermaßen in der Schwebe geblieben, bis zufolge von Aufklärung und Säkularisisation in der Neuzeit das Christentum entzaubert und zur Privatsache degradiert wurde – vom Papst allerdings ist bis auf den heutigen Tag sein Absolutheitsanspruch nicht preisgegeben worden, dass ihm als Stellvertreter Christi, d. h. des allherrschenden Gottes zumindest die geistlich-sittliche Führungsaufgabe im Abendland gebühre.
Daher bin ich der Meinung, dass auch dies verhängnisvoll-schreckensreiche, allerdings ebenfalls großartig-segensreiche, wechselvolle Schicksal des christlichen Abendlandes auf Caesars Zwangslage zurückzuführen ist, sich für seine Alleinherrschaft eine sakrale Legitimation verschaffen zu müssen und deswegen auch die kaum noch überbietbaren Ehrungen in Stadt und Reich nolens, volens gutzuheißen. Vielleicht hat Cicero daher richtig vermutet, dass er von seinem Welteroberungszug nach Indien und Germanien nicht mehr lebend zurückgekommen wäre, nicht jedoch aus Gründen seiner einige Wünsche übrig lassenden Gesundheit und vorzeitiger Altersgebrechlichkeit, sondern weil er auf Dauer im Osten, in Alexandria geblieben wäre – diesbezügliche Gerüchte kursierten längst in Rom (vgl. Sueton, 79), und bei der beabsichtigt enormen Ausdehnung des Reichs nach Osten wäre diese Entscheidung nur vernünftig gewesen. Bezeichnenderweise ist diese Idee von dem einen der beiden notorischen Nachahmer Caesars, von Marc Anton, dann auch punktgenau verwirklicht, nur allerdings vom gewitzteren zweiten gewaltsam vereitelt worden. Doch unterdes war eine Verlagerung der Reichsmitte auch deswegen inopportun geworden, weil keinem der beiden Gegenspieler die imperiale Erweiterung bis in die asiatischen Kernländer hinein gelungen ist, und die spätere Zweiteilung in West- und Ostrom ist wohl schon der Anfang vom Ende des römischen Reichs gewesen. Geschickt war Caesar von den Verschwörern zu seinem letzten Gang in den Senat auch damit geködert worden, dass ihm an den bewussten Iden des März bewilligt werden solle, „in den außeritalischen Provinzen den Königstitel (zu) führen und überall wo er hinkomme, zu Land und zu Meer, das Diadem (zu) tragen“ (Plutarch; 64). Sprich: Von Amts wegen sollte ihm gewährt werden, im orientalischen Sinn als Gottkönig zu gelten. Was in Gottes Namen kann Caesar aber bewogen haben, im Verrat an seinem nüchternen römischen Sinn für die Realitäten des Lebens, imgrunde mit Verrat an seiner Megalopsychia, auf Ehrungen erpicht zu sein, die nach obligatem Selbstverständnis des aufgekärten antiken Menschen seit Homer keinem Menschen zustanden, was anderes, frage ich, als die schicksalhaft-verhängnisvolle Begegnung mit dem Orient in der verführerischen Person der ägyptischen Kleopatra? Oder, ließe sich nochmals fragen, was wäre ihm denn überhaupt anderes übrig geblieben, nach den Siegen über Perser und Germanen, an welchen beiden Gegnern Rom ja letztendlich gescheitert ist, und nach der Eroberung eines Reiches, in Anbetracht von dessen Riesenausmaßen schon Augustus hat einsehen müssen, dass diesem selbst Roms größte Kraftanstrengungen nicht gewachsen waren, als sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen, sich ewig feiern zu lassen und seine Weltherrschaft zu genießen? Doch: „Genießen macht gemein“ (Faust, 10 260). Und: „Die Tat ist alles, nichts der Ruhm“ (10 188). Caesar hätte alles eingebüßt, was ihn groß gemacht hatte, wäre er zum orientalischen, gottgleichen Potentaten geworden. Zwar hätte er sich wohl kaum darauf verstanden, sich ins „λάθε βιώσας“ eines epikureischen Gartens zurückzuziehen, das hat ihm denn doch wohl gar zu fern gelegen, doch seiner epikureischen Natur zusammen mit Kleopatra auf Dauer zu frönen, wie später zu seinem Unheil Antonius, das hätte ihn geistig ruiniert – denn was wäre ihm als vergöttlichtem Pharao zu tun noch Wesentliches übrig geblieben? Fürwahr, möchte man meinen, Caesar ist zur rechten Zeit gestorben.
Ich vermag mir schlechterdings nicht vorzustellen, wie der „edelste der Männer, / der jemals lebt’ im Wechsellauf der Zeit“ (3.1), wie ihn Shakespeare aus dem Munde Marc Antons gerühmt hat, oder ihn von seinem Mörder Brutus „den ersten / von allen Männern dieser Welt“ (4.3) hatte nennen lassen, als orientalischer Erden-Gott seine Wahrheit und Würde als Römer hätte bewahren können, so wie er sie nach Plutarch und Shakespeare noch bei seinem Tod geziemend gewahrt hat: „Als er Brutus (den er liebte, d. Verf., vgl. Plutarch; 46), mit gezogenem Schwert unter den Gegnern erblickte, zog er die Toga übers Haupt und leistete keinen Widerstand mehr“ (Plutarch; 66; vgl. Sueton; 82; Shakespeare; 3.1) – in völligem Einvernehmen, deute ich, mit dem antiken Schicksals- und Vergänglichkeitsglauben und seiner heidnischen Furchtlosigkeit vor dem Tode. Noch kurz vor seiner Ermordung hat ihn Shakespeare diese Einwilligung in das lebensmutige Daseinsschicksal des sterblichen Menschen äußern lassen, das er aber fahrlässig und allzu selbstsicher mit seinem überheblichen Fortuna-Glauben als vermeintlicher Götterliebling zu seinem Verderben herausgefordert hat: „Der Feige stirbt schon vielmal, eh er stirbt, / die Tapferen kosten einmal nur den Tod“ (2.2).
Ganz im Gegensatz zu öfters geäußerten Verweisen, bei dem Abenteuer mit Kleopatra habe Caesar sich „verlegen“, d. h. die drängenden Staatsgeschäfte zu führen versäumt, oder auch, diese Begegnung habe ihm nur eine kurze, belanglose Affäre bedeutet,33 bin ich der Überzeugung, dass diese Beziehung für ihn zutiefst verhängnisvoll gewesen ist: Kleopatra ist für Caesar zur femme fatale in des Wortes ursprünglicher Bedeutung geworden. Denn hinter der ägyptischen Königin vermute ich die schicksalhaft-treibende Kraft, die ihn in das überspannte Welteroberungsabenteuer hineingetrieben hat, sowohl in den übermäßigen Wettkampf mit Alexander als auch in ein Gott-Kaiserwesen, das ihn sein Römertum gekostet hätte und wodurch im nachfolgenden römischen Kaisertum, das der Verlockung des Orients vollends erlag, der Asiatisierung des Abendlandes durch das Christentum für anderthalb Jahrtausend die Wege bereitet wurden. Caesar, will es mir vorkommen, ist der Versuchung erlegen, sich zum Gott erhöhen zu lassen, mag sein, weil ihm gar keine andere Wahl blieb, und er hat, verführt durch das Ägypten-Erlebnis, sein Heil in einer Zukunft als Gottkönig von der Art der Pharaonen und der sonstigen orientalischen gottgleichen Herrscher gesucht. Augustus war gut beraten, sich von dieser Anmaßung in der Öffentlichkeit zu hüten, aber hat heimlicherweise den zuletzt monarchischen Kurs seines Adoptivvaters eifrig fortgesetzt, wodurch es ihm gelang, die Verwandlung Roms und Italiens in eine unbedeutende Provinz des Weltreichs aufzuhalten, dessen Schwerpunkt alsbald im hellenistisch-orientalischen Osten lag, und in Gallien und Spanien sowie Teilen Britanniens und Deutschlands das antik-römische Erbe für eine zukünftige Wiederbelebung zu hinterlegen.
Wie wäre sich also Caesars Verhältnis zu Kleopatra vorzustellen, wenn man es nicht simpel als Torschlusspanik und amour fou eines alternden Mannes zu einer reizvoll-jungen Lolita ansähe, die er sich zur Bettgenossin genommen hat, weil sie sich ihm willig dazu angeboten hatte, er damals zweiundfünfzig, sie einundzwanzig? Unbedarft und nichtssagend hat Plutarch von Caesars „Leidenschaft für Kleopatra“ (47) gesprochen, Sueton immerhin von Liebe (vgl. 52) – sich die Frage auch nur zu stellen, ob sie seine Gefühle erwidert hat, scheint keinen der antiken Autoren interessiert zu haben. Selbstverständlich lässt sich auch in diesem Falle wieder nichts Genaueres nicht wissen, Caesar hat sich nicht zu dem Verhältnis geäußert und Kleopatra ebenfalls nicht: Alles bleibt abermals Mutmaßung aufgrund einiger mehr oder weniger glaubhafter Tatsachen-Angaben in den späteren Quellen. Zu gönnen wäre den beiden, eine so wunderbare Liebesbeziehung erlebt zu haben, wie Shakespeare sie sich für Kleopatra und Antonius ausgedacht und mit Kleopatras Freitod über alle Zweifel hinaus herrlich besiegelt hat (vgl. v. Verf.: Shakespeare und das neuzeitliche Heidentum, S. 77 ff.).
Was hier an den Überlieferungen interessiert, ist allein, was sich daraus zur Klärung von Caesars Wesen gewinnen und womöglich auf seine Zukunftspläne rückschließen ließe. Der Liebreiz, nicht nur sex-appeal, der von dieser vielleicht berühmtesten, vielleicht bedeutendsten Frau der Weltgeschichte seine Wirkung auf Caesar nicht verfehlt hat, der damals im Zenit seines Lebenserfolgs stand, einer der mächtigsten Männer aller Zeiten, dürfte nicht leicht von irgendeinem anderen weiblichen Wesen, alles zusammengenommen, übertroffen worden sein. Ein kleiner Eindruck ihrer berückenden Erscheinung lässt sich aus Plutarchs Beschreibung ihrer sechs Jahre späteren Erstbegegnung mit Antonius gewinnen, „gekleidet und geschmückt, wie man Aphrodite gemalt sieht“ (26), an Deck einer prächtig vergoldeten Galeere. Der apollinische Plutarch hat resümiert: „An und für sich war ihre Schönheit, wie man sagt, gar nicht so unvergleichlich und von der Art, daß sie beim ersten Anblick berückte, aber im Umgang hatte sie einen unwiderstehlichen Reiz, und ihre Gestalt, verbunden mit der gewinnenden Art ihrer Unterhaltung und der in allem sie umspielenden Anmut, hinterließ einen Stachel. Ein Vergnügen war es auch, dem Klang ihrer Stimme zu lauschen. Sie wußte ihre Zunge wie ein vielstimmiges Instrument in jede ihr beliebende Sprache zu fügen und bediente sich nur im Verkehr mit ganz wenigen Barbaren eines Dolmetschers, … während die Könige vor ihr es nicht einmal fertig gebracht hatten, die ägyptische Sprache zu beherrschen, einige sogar das Makedonische verlernt hatten“ (27). Auf den alten Schwerenöter und anscheinend unwiderstehlichen Womenizer, wie Sueton und Cassius Dio ihn überliefert haben, dürfte dieses morgenlandschöne Luxusweibchen unwiderstehlich gewirkt haben, hinzu kam die hoch-erotische und verführerische Inszenierung ihrer Erstbegegnung. Sie war damals von ihrem erst dreizehn Jahre alten Bruder, mit dem sie nach Pharaonensitte verheiratet war, der sie aber vom gemeinsamen Königsthron ins Exil vertrieben hatte, zwecks Schlichtung der Thronstreitigkeiten vorgeladen worden. Heimlich hatte sie sich dann, eingerollt in ein Bündel, von einem Vertrauten zu Caesar in den Palast bringen lassen – „schon dieser listige Einfall“, schreibt Plutarch, „der Kleopatras mutwilliges Wesen verriet, gewann Caesars Herz, und vollends erlag er ihrer Anmut und dem Reiz ihres Umgangs“ (49). Denn diese junge Schönheit, gewiss very sexy, vertraut mit allen Verführungskünsten einer uralten Kultur in Ansehung raffinierter Kleidung, von Schmuck und Schminke, war nicht nur von ansehnlichstem Äußeren, angenehmster Stimme und einschmeichelnden, kultivierten Umgangsformen, wie in den Quellenschriften ausgeführt, sondern auch hoch gebildet – neun Sprachen soll sie wie ihre Muttersprache beherrscht haben. Und, was mehr zählte, sie war eine Königin und nach ägyptischem Glauben gar eine Göttin – vieles spricht dafür, dass sie sich als „Isis incarnata“ gegeben, vielleicht gefühlt hat, und Caesar soll ihr später – horribile dictu – offen als Göttin mit einer Isis-Venus-Statue im Tempel der römischen Venus Genetrix gehuldigt haben. Doch mag sich der alte Skeptiker über ihren Göttinnen-Status, zumindest innerlich, auch wohl eher belustigt haben, die felsensichere Legitimation als Gottheit, die diese ägyptisch-hellenistische Königin bei ihrem Volk besaß, dürfte ihn schon interessiert und beeindruckt haben. Und womöglich noch eindringlicher dürfte ihm imponiert haben, dass sie in einer Ahnenschaft von Pharaonendynastien über Tausende von Jahren stand und ihn darüber hinaus als Nachfahrin des mazedonischen Alexander-Generals Ptolemäus, späteren selbsternannten Königs von Ägypten, ganz dicht an die längst mythisch gewordene Welt und Gestalt Alexanders des Großen heranbrachte – und die rassig-selbstbewußte Kleopatra dürfte diese ihre königlich-griechische Abkunft im zusätzlichen Glanz ihrer Pharaonenherrlichkeit und des in ihrem Land fraglos anerkannten Göttinnenstatus kaum unter den Scheffel gestellt haben. Denn nach allem, was sich darüber wissen lässt, hat sie sich bereits in diesen jungen Jahren und im Streit mit ihrem Bruder zur wahren Herrscherin von Ägypten auserwählt gefühlt, auch die ambionierte spätere Liaison mit Marc Anton scheint doch zu beweisen, dass sie sich zu Höherem berufen glaubte, zur gottgleichen Herrscherin zumindest im orientalischen Teil des römischen Reiches an der Seite von Antonius – genau dieses Anspruchs wegen ist sie jedenfalls von Octavian bis auf den Tod bekämpft worden. Und im Verein mit Antonius hätte sie meiner Überzeugung nach nichts anderes als Caesars durch sie inspiriertes Vorhaben in die Tat umzusetzen versucht: Ein monarchisch-römisches Alexander-Reich mit Schwerpunkt im Osten zu begründen, so wie es später vom Christen-Kaiser Konstantin mit Konstantinopel/Byzanz als Zentrum ins Leben gerufen worden ist.
Man wird sich also vorstellen dürfen, dass Caesar in Kleopatra nicht bloß die reizende Gespielin eines amourösen Abenteuers gesehen hat, sondern so etwas wie eine ebenbürtige Partnerin, der er seine innersten Gedanken und Pläne in puncto Neuordnung des Reichs anvertrauen konnte, ja, die ihm dabei aus Erberfahrung mit Rat und Tat zur Seite stehen konnte und ihm auch geistig derart gewachsen war, wie er es ob seiner einschlägigen Überlegenheit noch nie zuvor erlebt hatte. Denn diese Kleopatra, mit achtzehn Jahren zusammen mit ihrem jüngeren Bruder auf den Pharaonenthron erhoben und von dessen Höflingen dann ins Exil vertrieben, hatte selbstbewusst und unbeugsam seither um ihren Herrschaftsanspruch gekämpft und in Syrien ein Heer geworben, womit sie sich mit Gewalt in Ägypten Recht verschaffen wollte. Aufgewachsen war sie in einem Königshaus, wo die Herrschaft sich mit allen Mitteln, erlaubten wie unerlaubten, auch Gift und Mord, gegen die Intrigen der Höflinge, Griechen wie Ägypter, hatte behaupten müssen, und zuletzt dazu auch noch gegen die Potentaten aus Rom, die längst über die Geschicke des Landes mitbestimmten, auch seiner reichen Kornernten wegen, die fürs tägliche Brot der Römer unentbehrlich waren – Kleopatras verstorbener Vater beispielsweise, um sich auf dem Thron halten zu können, schuldete Caesar Millionensummen, die dieser nunmehr vor Ort einforderte, was natürlich von der Umgebung des Throns verweigert wurde. Und so hat er schließlich offen für Kleopatra Partei ergriffen, die wusste, was sie wollte und stolz ihren Anspruch auf den Pharaonenthron geltend machte, nachgerade mit seiner Hilfe, was ihn einen halbjährigen Krieg beinahe zu seinem Verderben gekostet hat – doch am Ende konnte er sie als alleinige und rechtmäßige Königin von Ägypten zurücklassen, da er schließlich notgedrungen aufbrach, um sich wieder um Rom und Reich zu kümmern, was ihm beides während dieser ägyptischen Hoch-Zeit nicht allzu viel bedeutet zu haben scheint. Das kecke Persönchen, stolz auf ihren angeborenen Adel, kein kleines Mädchen mehr, sondern eine selbstbewusste, erwachsene Frau; begehrenswert, ja der Liebe würdig selbst für einen Caesar, weil sie ähnlich ambitioniert war wie er; die sich bedenkenlos jedes Mittels zu bedienen bereit war, um wieder auf den Thron zu kommen; fest entschlossen, zu diesem Zweck dem Römer zu Willen zu sein; selbstbewusst ohne alle Skrupel und Zweifel, willensstark, tatkräftig, rücksichtslos. Und diesem weiblichen, leidenschaftlichen Machtwillen, königlich von Geblüt und dank Selbstwahl, verstand es obendrein, von Caesar geschwängert zu werden, zumindest scheint er davon selbst überzeugt gewesen zu sein. Antonius hat später vor dem römischen Senat bezeugt, also höchst amtlich beglaubigt, Caesar habe den von Kleopatra geborenen Sohn, genannt Caesarion, kleiner Caesar, als sein eigen Fleisch und Blut ausdrücklich anerkannt (vgl. Sueton; 52). Und Octavian, obwohl man das selbstredend aus seinem Kreis heraus geleugnet hat, scheint diese Anwartschaft immerhin insoweit anerkannt zu haben, dass er den Knaben eiligst hat umbringen lassen. Für Caesar, dem es trotz seiner vielen Ehen und Liebschaften bis dahin anscheinend nie gelungen war, einen Sohn zu zeugen, muss diese unverhoffte Vaterschaft immens viel bedeutet haben, denn sie gewährte ihm bei dem üblichen und bezeugt auch bei ihm als stark ausgeprägt vorhandenen paternalistisch-römischen Sinn für den Fortbestand von Familie und Sippe nicht bloß die Genugtuung, dass sein Name in seinen leiblichen Nachkommen weiterleben würde, sondern darüber hinaus, was die Lösung all seiner politischen Probleme verhieß, die begründete Hoffnung auf eine Erbmonarchie, wie er sie in Ägyptenland zufolge Kleopatras Ptolemäer-Ahnenschaft und ungleich großartiger noch durch die in unabsehbere Vergangenheiten hinabreichenden und wie über alle Erden-Vergänglichkeit erhabenen Pharaonen-Dynastien inspirierend kennengelernt hatte. Daher kann es kaum verwundern, dass er auch nach Beendigung der Thronstreitereien, nach fester Etablierung Kleopatras als alleiniger Throninhaberin, noch zwei lange Monate in Ägypten geblieben ist, und es sich auf einer Nilpartie mit der geliebten Frau anscheinend hat gut gehen lassen, unbekümmert um die Weltgeschicke, die ohne ihn nicht von der Stelle rückten, weil in Rom alles von seinen Entscheidungen nach Pharsalus abhing. Mir wäre recht, wenn nicht Sueton mit seinem missgünstigen Kommentar von „Gelagen oft bis zum Morgengrauen“ auf einer „Luxusjacht“ (52) schon die ganze Wahrheit über diese Zweisamkeit kundgetan hätte, sondern sehr viel einfühlsamer Otto Seel, dem ich eine tiefsinnigere Erfassung des Römertums und Julius Caesars zuzutrauen bereit wäre, der luzid gemeint hat, dass „Caesar, der Mensch der Fülle, in Kleopatra die Fülle des Lebens“ gefunden hätte (Cicero, S. 246); kein Dummerchen also und eine willfährige Konkubine, sondern einen Menschen, „dem er sich in seiner völlig amoralischen Großgeartetheit so nahe fühlen durfte, daß alle Zwecke, Absichtlichkeiten, Beflissenheiten dahinter versanken und der Augenblick in sich selber zulänglicher Zweck und hinreichender Grund wurde“ (ebd., S. 245); kurz, wie von Horaz in augusteischer Zeit über die damals zur „persona ingrata“ erklärten, intriganten ägyptischen Hure in klassischer Lakonität, verwundert und treffsicher, verlautbart: Kleopatra sei ein „Weib ohne Niedrigkeit gewesen“ (non homilis mulier) (zit. Seel, ebd.); von Seel ist sie gar ein „dämonisches Weib“ genannt worden (ebd.), „dämonisch“ wohl im Sinne Goethes zu verstehen. Von Caesar scheint sie jedenfalls in höchsten Ehren gehalten worden zu sein, nach Geburt ihres Sohnes hat er sie im Jahre 46 nach Rom nachkommen lassen, ihr eine prächtige Wohnung in seinen privaten Gärten jenseits des Tibers zugewiesen, von woher sie erst nach seiner Ermordung in ihre Heimat zurückgekehrt ist, und hat, wie schon erwähnt, eine Statue von ihr im Tempel zu göttlicher Verehrung aufstellen lassen. Was er nach seiner Rückkehr vom Asien-Abenteuer mit der Mutter seines Sohnes wirklich vorhatte, lässt sich natürlich wieder nur mutmaßen. Mir selbst scheint alles, was darüber bekannt ist, dafür zu sprechen, dass er sie nach siegreichem Alexanderzug und wohl beabsichtigter Scheidung von Calpurnia als Gemahlin und Mutter seines Erben zur Weltherrscherin und Göttin neben sich auf einen Gottkönigsthron in einer Art orientalisch-hellenistischer Weltmonarchie (vgl. Eduard Meyer, S. 509) zu erheben vorhatte. Ein Gesetzentwurf, der während seiner Abwesenheit eingebracht werden sollte, hätte ihm gestatten sollen: „Er könne heiraten, wen und wie viele Frauen er wolle, um männliche Nachkommenschaft zu erhalten“ (Sueton; 52); und es hat damals, wie bereits gehört, ein in Rom anscheinend weit verbreitetes Gerücht gegeben, er plane, seinen Residenzsitz nach Troia oder Alexandria zu verlegen (vgl. Sueton; 79) – beides scheint mir bemerkenswert auf Kleopatra zu passen und ebenfalls auf sein Vorhaben, sich offiziell zum orientalischen Gottkönig erklären zu lassen in Nachahmung der asiatischen Seleukidenherrscher, die sich ihrerseits in der Nachfolge Alexanders verstanden. Im Übrigen lag bereits ein „gemeinsamer Beschluss der Städte, Gemeinden und Völkerschaften (d. i. Landbezirke) von Asia (vor), (ihn) als ‚in die Erscheinung getretenen Gott und Heiland des gesamten Menschengeschlechts’“ (zit. Eduard Meyer, S. 509) zu verehren. Dass Caesar in seinem Testament dann nicht Caesarion, sondern Octavian zum Erben erklärt hat, schließt nicht ohne weiteres aus, dass er das in Zukunft nicht noch zu ändern vorgehabt hätte – nach römischem Recht war völlig unmöglich, das Erbe einem unehelichen Kind zu übertragen (vgl. Meyer, S. 522). Und genauso wenig konnte er ein dreijähriges, von ihm gegen alle Gepflogenheiten als Erben anerkanntes Kind mit seiner vielfach bewunderten, aber mehr noch angefeindeten Mutter schutzlos in Rom zurückzulassen. Sehr wohl kann man aber mit dieser testamentarischen Verfügung Caesars ausgesprochenen Familiensinn im Sinne altrömischer Patrizier- und Patronatsart und -gesinnung nachdrücklich bestätigt sehen, denn Octavian war simpel sein nächster Blutsverwandter, einer seiner drei Großneffen – das Testament also vielleicht eine provisorische Maßnahme, die später hätte revidiert werden sollen, zumal darin die Vormünder für einen eventuellen Sohn bereits ausdrücklich vorgemerkt waren. Oder soll man im Falle von Octavians Adoption so etwas wie eine prophetische Erkenntnis Caesars vom sozusagen prädestinierten Erben annehmen, als welcher Augustus sich später ja in der Tat herausgestellt hat? Auch in diesem wichtigen Punkt muss es wieder bei Mutmaaßungen bleiben, die fundamentale Verschiedenheit der Charaktere hat es zumindest Eduard Meyer fraglich erscheinen lassen, „ob Caesar für Octavian große Zuneigung empfunden hat und ihn innerlich als den geeigneten Nachfolger betrachtet hat“ (S. 524). Und von Meyer ist dem als seine Überzeugung hinzugefügt worden, dass Augustus nach „seinem Charakter und seiner gesamten Denkweise … den Weg Caesars nicht gehen konnte“ (S. 547). Doch diese letzte Annahme sollte vielleicht dahingehend noch differenziert werden, dass Octavian-Augustus immerhin allenthalben in die Fußstapfen seines Adoptivvaters getreten ist, den er flugs zum „Divus Julius“ erklären ließ, wodurch er zum göttlichen Sohn eines göttlichen Vaters mutierte. Und im Übrigen ist er so behutsam und geschickt bei der Nachfolge vorgegangen – nach meiner Überzeugung allerdings auch verschlagen, betrügerisch und in perfekter Tarnung –, dass niemand es merkte. Aus durchsichtigen Gründen hat er sich zwar anders als Caesar gewitzt davor gehütet, um nicht am eingefleischten Widerstand dagegen zu scheitern, in Rom und Italien als Gott verehrt zu werden, aber im übrigen Reich hat er es gnädig geschehen lassen. Wenn das von Meyer so gedeutet wird, dass er seine Stellung in der Heimat in „feiner Weise“ mit einer „Wiederbelebung … der altrömischen Religion verbunden habe“ (S. 512), so wird man solch „klug erwogene Abgrenzung“ – welche Beurteilung von Augustus’ Handlungsweise ich keineswegs bezweifle – aber wohl kaum für die eines wahrhaft Gläubigen der altrömischen Religion halten können, die doch längst toter war als tot. Und wenn Meyer hinzufügt, im Unterschied zu Caesar habe Augustus an Ideale geglaubt, gemeint ist damit hier das Ideal des Prinzipats (vgl. Meyer, S. 468), so muss man schließen, dass die „absolute Monarchie“ (S. 465), an die Caesar glaubte, für Meyer eben kein Ideal war: Denn „Caesar glaubte nicht an Ideale“ (S. 468). Wohl richtig! Augustus aber doch? Man wird genauer zusehen müssen! Meine Meinung vorwegnehmend, hat Augustus genauso wenig oder genauso viel an Ideale oder die Religion geglaubt wie Caesar. Oder anders gewendet: Warum sollte das Prinzipat oder die Republik für ein Ideal gehalten werden dürfen, die Monarchie aber nicht? Und weiter: Ist nicht Augustus in Tat und Wahrheit ein durch und durch, wenn auch verkappter Monarchist gewesen, wogegen der ermordete Caesar erst gar nicht mehr dazu werden konnte? Die Republik, die das Reich erobert hat, hatte sich jedenfalls als unfähig erwiesen, es zu erhalten. Caesars Mörder als Ausagierende republikanischer Ideale waren unfähig zu herrschen, zumindest konnten sie nicht beweisen, dass sie dazu imstande gewesen wären. Der Prinzipat des Augustus, der sich gegen den zweiten Rächer und selbsternannten Erben Caesars, Marc Anton, und gegen dessen Monarchen-Anspruch schließlich durchgesetzt hat – Marc Anton allerdings genauestens in Nachfolge Caesars und abermals mit Kleopatra an seiner Seite –, hat es zumindest heutigen Augen nicht verbergen können, dass diese hochgelobte Herrschaft nichts anderes als eine Monarchie gewesen oder zumindest darauf hinausgelaufen ist. Caesars rächender Geist hat triumphiert, der schon Brutus und Cassius das Fürchten gelehrt und sie zum Scheitern gebracht hatte. Zunächst kaum bemerkt, aber unwiderstehlich hat die Idee der Weltmonarchie mit orientalischem Gottkaiser an der Spitze die Prinzipatsidee ausgehöhlt und mündete, über den Caesaren-Größenwahn vermittelt, schließlich im konstantinisch-christlichen Ein Gott/Ein Reich-Glauben, der sich den Freiheits- und zumal Gleichheitsbedürfnissen der Massen verdankte, die es auf der religiösen Schiene schafften, den schließlich einzigen Herrscher in den Himmel abzuschieben, wodurch im Prinzip unterschiedslos alle miteinander zu seinen gleichen Untertanen gemacht waren, Brüder und Schwestern des Gottessohnes. Im Osten haben der Kaiser und seine Hierarchen, später die Kalifen und Imame, die gottgewollte Macht und Vorherrschaft auf Erden weiterhin beansprucht, im Westen Kaiser, Könige und Feudalherren und dazu noch der Papst und seine Kirchenhierarchie, die sich allesamt als beauftragte Stellvertreter der höchsten Macht etwas weniger gleich als die übrigen gedacht und gefühlt haben, bis auch sie dem Druck der vereinigten Schwachen, sprich der Demokraten nachgeben und weichen mussten oder noch weichen werden. „Unermeßliches Elend hat Caesars Ermordung über die Welt gebracht“, so Meyer (S. 547). Das ist ohne Frage richtig, aber wer möchte entscheiden, ob der ägyptische Größenwahn Caesars und Kleopatras, hätte er obsiegt, nicht noch größeres Unheil angerichtet hätte, so wie die Verruchtheiten im Namen des Gottesgnadentums wahrlich unermessliches Unheil angerichtet haben, was der Überzeugung des gleichfalls von ihm gestifteten Segens keinen Abbruch tut – hier wie überall bei solchen Vergleichen wird man eine genauere Bilanz zu ziehen versuchen müssen, so unmöglich das auch ist. Doch wie immer, die welthistorische Relevanz des hohen Paares „Caesar und Kleopatra“ lässt sich kaum in Abrede stellen. Geziemend sollte daher auch Caesars Ermordung in mythischer Dimension gesehen werden, à la Shakespeare: Wenn Caesar in den Augen der Brutus, Cassius etc. auch kein Gott gewesen sein mag, so doch ein sich Quasi-Göttlichkeit anmaßender „einziger Mann“ (one only man, 1.2); ein Mann, „zum Gott erhöht“ (ebd.); jemand, der ungehörig und verstiegen „nach der Königswürde“ strebte (vgl. Plutarch; 60; Sueton; 79); oder der zumindest der Eine, der Einzige ohnegleichen sein wollte, von dem für sie unerträglich dadurch alle anderen zu Gleichen degradiert wurden, zu Untertanen, Adlige wie Plebejer. Um der Freiheit willen, d. h. um wenigstens für die Patrizier die Gleichheit zurückzugewinnen, musste der Eine fallen, der sie verhinderte. Jeder Römer, so hatte man sich nach dem ersten Königsmord an Tarquinius Superbus verschworen, besäße das Recht, ja die Pflicht, einen solchen Usurpator der Freiheit, d. h. alleiniger Herrschaft zu töten – auch Brutus beansprucht nach Shakespeare genau dieses Recht (justice), gedeckt durch das geheiligte Ethos des republikanischen Staates, als die einzige Rechtfertigung der blutigen Tat (vgl. 4.3). Doch der abgründige Shakespeare hat, denke ich mir, tiefer gegraben als bis auf den Grund des republikanisch-römischen Rechts, vielleicht in Reminiszenz an die mythische Ermordung des ersten römischen Königs, des herrschsüchtig gewordenen Romulus, den die Senatoren ob dieses Frevels zerrissen haben sollen. Bei der endgültigen Entscheidung der Verschwörer zur Ermordung des Tyrannen lässt er seinen Brutus in feierlich-sakraler Redewendung sprechen: „Laßt Opferer uns sein, nicht Schlächter“ (2.1); „zerlegen lasst uns ihn, ein Mahl für Götter“ (ebd.). Otto Seel, der nach Entsprechendem auch auf Caesars Seite gesucht hat, der vor dem letzten Gang in den Senat alle Warnungen und angeblichen Vorzeichen ungnädig in den Wind geschlagen hatte – „for always I am Caesar“ (ich bin doch immer Caesar, I. 4. 2. 212; vgl. „Ich ließe wohl mich rühren, glich ich euch, 3.1); „doch ich bin standhaft wie des Nordens Stern“ (ebd.); „doch einer nur behauptet seinen Stand … In der Menge weiß ich einen nur, / Der unbesiegbar seinen Platz bewahrt, / Vom Andrang unbewegt (unshak’d of motion); daß ich der bin (that I am he), / Auch hierin laßt es mich ein wenig zeigen“ (ebd.): Wer hätte diese überaus fragwürdige Mischung aus Überlegenheit, Selbstherrlichkeit und Überheblichkeit, aus Lebenssättigung und Lebensüberdruss, vielleicht sogar mit einem zusätzlichen Gran Todessehnsucht; wer die tragische Verirrtheit in vermeintlicher Beherrschung seines Lebensglücks und Meisterung der phantastischen Zukunftspläne; wer alle heillos existentielle Fragwürdigkeit, Hinfälligkeit, Zerbrechlichkeit, Nichtigkeit des Menschenwesens bewegender bezeugt als Shakespeare mit seiner Gestaltung von Caesars Lebensende? –, hat geglaubt, bei Caesar etwas von einem „willentlichen Opfergang in den Tod“ (Caesar-Studien, S. 91) annehmen zu dürfen. Das scheint mir aber Caesars ungemeinem Lebensmut etwas Gewalt angetan und sein Wesen allzu moralisch-religiös erhöht bewertet zu haben in Verkennung der faktischen, absurden Zufälligkeit dieses Endes: Und welchem Gott hätte sich denn dieser lebenbejahende, sich selbst genießende Skeptiker, ja Zyniker und durch autonome Größe legitimierte, königliche Mensch aufopfern sollen?
Indes soll die Annahme, dass Caesar eine gewisse Ahnung von der Verschwörung und einem drohenden Attentat gehabt hat, damit nicht in Abrede gestellt werden; das anzunehmen, liegt doch nur zu nahe. Auch überlieferte Aussprüche von ihm wie: Er habe lange genug gelebt; oder noch einen Tag vor seiner Ermordung geäußert: „Der angenehmste Tod“ sei ein „plötzlicher“ und „unerwarteter“ (Sueton; 87; vgl. Plutarch; 57); ebenfalls seine zuletzt geradezu anzüglich-fatalistische, verachtungsvolle Vernachlässigung des Personenschutzes, so, als ob er sich als Gott seiner Unsterblichkeit sicher sein oder zumindest seinem Glücksstern voll vertrauen könne, lassen den Verdacht kaum gänzlich unterdrücken, dass er, lebens- oder zumindest ruhmessatt, sein Ende zwar wohl nicht gerade gesucht hat, aber auch nicht davor geflohen ist – dazu hatte er in den vielen Kämpfen zuvor dem Tod zu oft ins Auge geblickt. Die große Gebärde, mit der er starb – das verständnislos-resignierende „Et tu, Brute! Then fall, Caesar!“ (3.1; vgl. Sueton; 82), wie der rührende Versuch – da er sein Haupt mit der Toga verhüllt und keinen Widerstand mehr geleistet hätte (vgl. Plutarch; 66) –, „mit Anstand zu fallen“, wie Sueton sich ausgedrückt hat (82); also in Achtung seiner „dignitas“ und mit stolz-aristokratischer Verachtung seiner Mörder; aber antik-demütiger Anerkennung des Todes als des absoluten Herrn, dem jeder Sterbliche sein Leben schuldet –, dies bewegende Zeugnis zugleich von Hoheit und Nichtigkeit des Menschenwesens mag eine Ahnung davon aufkommen lassen, dass Caesars Tod eine Art mythischen Urmusters zu vergegenwärtigen vermochte: Vernichtung und zugleich Vergottung – ungläubig gesprochen: Erhöhung ins Archetypisch-Vorbildhafte – eines Menschen wie im Falle des römischen Urkönigs Romulus, Tod und Apotheose: „Romulus, zum Tyrannen entartet, (wird) von den Senatoren in Stücke gerissen“ hat es der für diese mythischen Zeiten zuständige Wilhelm Burkert ausgedrückt (vgl. Caesar und Romulus Quirinus, S. 358). Aber danach ist Romulus zum Gott Quirinus erhoben worden, und die Römer haben sich nach diesem Gott zur Selbstehrung Quiriten genannt. Auch Caesar ist von Angehörigen des Senats wegen Verdachts auf Tyrannei getötet worden, und der tote Caesar wurde bereits von Augustus zum Gott erhoben, zum „Divus Julius“. Und danach ist sein Name von den monarchischen Potentaten zweier Jahrtausende als erhabenster Titel genutzt und zum Hoch- und Vorbild eines wahren „Kaisers“ und „Zaren“ von Gottes Gnaden verklärt worden. Dass seine vermeintlichen Vernichter sich vollständig in die mythische Rolle des Königsmörders haben hineindrängen lassen, zumal Brutus in die seines namengleichen Urahnen Brutus, Mörders des entarteten Königs Superbus, dürfte für einen ahnen- und familienbewußten Römer unwiderstehlich gewesen sein. Zudem war Brutus Gemahlin Porcia die Tochter von Cato Uticensis, des ältesten und unversöhnlichsten republikanischen Caesarfeindes. Noch nach dessen Tod hatte Brutus mit diesem Erzrepublikaner sympathisiert und ihm einen rühmenden Nachruf gewidmet. Caesar mag das denn doch geärgert haben, der ihn, der in Pharsalus gegen ihn gekämpft hatte, freundschaftlich begnadigt und sogar in seinen engeren Führungskreis aufgenommen hatte: Wie symptomatisch undankbar-unbelehrbar muss es ihm daher vorgekommen sein, als auch Brutus mit dem Dolch auf ihn eindrang und einstach, um seine mythische Rolle auszuagieren – von Shakespeare ist der „noble Brutus“ erhöht und verherrlicht worden wie kaum ein anderer Mensch, er hat ihm einen überaus ehrenvollen Freitod geschenkt und ihm aus dem Munde seines Feindes Antonius unüberbietbar eine römisch-lakonische Rühmung nachrufen lassen: „This was a man!“ (ebd.).
Doch ist dies letzte, in Person von Brutus wohl auch – historisch gesehen – einigermaßen ehrenhafte Aufbäumen der Oligarchie schlussendlich vergeblich gewesen, zu Philippi hat der Geist Caesars gesiegt (vgl. Shakespeare, 4.3) – eine prinzipielle Bilanz von Wesen und Herrschaft Caesars möchte ich, eingerechnet in die Generalbilanz Roms, erst zum Ende dieses Kapitels ziehen.